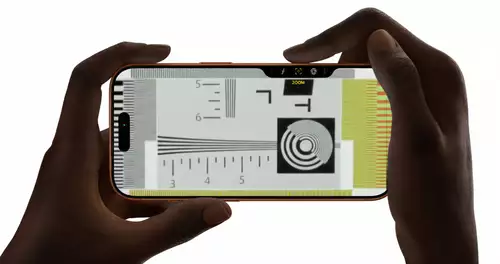Auch wenn mit Prozessor (CPU), Grafikkarte (GPU) und Hauptspeicher-Ausstattung schon die Rahmendaten eines Rechners für die Videobearbeitung grob abgesteckt sind, lässt sich auch noch einiges zum Drumherum (SSD, HDDs, Netzteile und Gehäuse) beachten:
Solid State Disc (SSD) vs. Harddisk-Drive (HDD)/Festplatte
Auf einer Harddisk (HDD, auch Festplatte), werden die Daten auf rotierenden Magnetplatten gespeichert. Der Zugriff erfolgt dabei ähnlich einem Plattenspieler mit einem beweglichen Schreib-Lesekopf. Aktuelle Festplatten erreichen zwar heutzutage bemerkenswerte, konstante Datenraten zwischen 100 und 200 MB/s. Allerdings sind die Zugriffszeiten bei willkürlichen Schreib-Lese-Vorgängen relativ hoch, weil der Schreib-Lesekopf erst einmal mechanisch auf die richtige Spur geschoben werden muss um dann noch durchschnittlich eine halbe Umdrehung zu warten, bis der angefragte Sektor "vorbeikommt". Wenn man viele kleine Datenpakete schreibt und wieder löscht und die Festplatte deswegen nach einer Zeit für größere Datenpakete keine zusammenhängenden Bereiche mehr auf der Platte findet spricht man vom Zustand der Fragmentierung. Dies bedeutet, dass sich im Laufe der Zeit die Daten immer mehr über die Magnetplatten verteilen und nicht mehr "am Stück" vorliegen.

Weil der Schreib-/Lese-Kopf in diesem Fall immer wieder andere Bereiche auf den Magnetplatten anfahren muss und die Daten nicht wie bei einer Schallplatte "in einem Rutsch" lesen kann, bremsen diese verlängerten Positionierungszeiten den Zugriff bei einer fragmentierten Festplatte deutlich aus. Daher eignen sich Festplatten bei der Videobearbeitung eigentlich am besten für wenige, große Dateien, die dazu keine Datenraten von weit über 100 MB/s erfordern. Ergo für das Ablegen von großen Clips und anderem Rohmaterial, das man zu Projektbeginn am besten auf eine frisch formatierte Platte kopiert.
SSDs (Solid State Drives oder die nicht so gängige deutsche Bezeichnung Halbleiterlaufwerk) speichern die Daten dagegen auf Flash-Speicherchips. Da hier keine beweglichen Teile vorhanden sein müssen, sind dieses weitaus unanfälliger gegenüber Stößen oder Fallschäden und die Zugriffszeiten sind über den gesamten Speicherbereich gleich schnell. Die klassische Bauform als 2,5 Zoll-Modell hat dabei die gleichen elektrischen Anschlüsse wie eine Festplatte/Harddisk, weshalb diese auch über herkömmliche SATA-Anschlüsse wie Festplatten betrieben werden können.

Die gängigsten SSDs, die über Serial-ATA 6 Anschluss finden, reizen heutzutage die maximal möglichen SATA6-Datenraten um die 500MB/s schon voll aus. Einen eigenen slashCAM-Artikel zu gängigen SSD-Interfaces findet ihr hier.
Beim eingesetzten FlashSpeicher gibt es mittlerweile drei Klassen, die sich auch auf die Medienpreise auswirken: Je mehr Bit pro Zelle gespeichert werden können, desto günstiger, aber auch langsamer ist der eingesetzte Speichertyp, besonders beim Schreiben.
Die aktuell günstigsten SSDs nutzen TLC-Speicher (drei Bit). Dieser ist besonders beim Schreiben langsamer, als die teureren MLC/SLC-Speicher. Doch fast alle TLC-Modelle haben jedoch in der Regel einen ziemlich großen Pufferspeicher, weshalb diese Modelle bei kleineren Dateien ebenfalls die maximale SATA-Schreibrate von ca. 500 MB/s erreichen. Wer jedoch mit einer Kamera über einen längeren Zeitraum 4K-RAW mit Datenraten über 200MB/s verlässlich schreiben muss, greift meistens schon aus Sicherheit zu MLC- oder SLC-Speicher.
Was für was?
Als Systemplatte in einem PC oder MAC sollte es auf jeden Fall eine SSD sein, denn hier spürt man den Unterschied gegenüber einer Festplatte deutlich. Praktisch gar nicht spürbar ist hier jedoch der Unterschied zwischen SLC-, MLC- und TLC-Modellen.
Wer im Rechner einen Cache für RAW-Bearbeitung anlegen will sollte dagegen am besten auf NVMe-SSDs mit möglichst schnellem Speicher setzen. Diese NVM-SSDs werden direkt über PCIe angesprochen und erlauben aktuell Datenübertragungsraten von ca. 3.000MB/s. Gerade in Resolve macht so ein Cache einen großen Unterschied. Ein aktueller Test von Samsungs neuesten NVMe-SSDs der 970er Reihe zeigt jedoch, dass der Unterschied zwischen MLC und TLC mittlerweile auch stark geschrumft ist. Der Preisunterschied allerdings auch.
Wer szenisch arbeitet und dabei auf komprimiertes RAW oder ProRES setzt, schafft es in der Regel dagegen bei den aufgezeichneten Datenraten um die 100 MB/s zu bleiben. In diesem Fall können auch besonders günstige Festplatten als Speicher für die RAW-Daten beim Schnitt eingesetzt werden (solange man nicht Multitrack-Editing benötigt).
Hierbei sollte man allerdings beim "befüllen" darauf achten, die genutzten Festplatten nicht sonderlich fragmentiert werden. Dies erreicht man einerseits damit, dass man möglichst wenig Daten löscht und die Festplatte folglich auch nicht als Speicher für sonstige, viele kleine Dateien nutzt. Oder indem man das Laufwerk von Zeit zu Zeit defragmentiert, was auch im Hintergrund stattfinden kann. Jedoch sollte man tunlichst nicht während der Schnitt-Arbeit defragmentieren, weil es hierbei ziemlich sicher zu Rucklern beim Playback kommt.
Netzteile
Bei der Wahl des Netzteils gibt es weniger Pauschales zu empfehlen. Formfaktor und Anschlüsse müssen natürlich zum Gehäuse und zum Mainboard passen. Spannender wird es bei der Dimensionierung. Grundsätzlich sollte man die Watt-Zahl nicht zu knapp an den eigenen Komponenten dimensionieren. Dazu sind die Angaben zur Dauerleistung bei den Herstellern nicht immer zuverlässig. Wenn man plant über die Lebensdauer des Rechners immer wieder Komponenten auszutauschen, sollte man das Netzteil eher großzügig überdimensionieren sowie einen Markenhersteller wählen. Der Preisunterschied zwischen guten Marken-Netzteilen und No-Name Marken ist meistens gemessen am Gesamtbudgets eines Rechners vernachlässigbar. Den Aufpreis für herausragende Modellen bezahlt man meistens für außergewöhnlich gute Effizienzwerte sowie für einen sehr geringen Geräuschpegel. Schlechte, meist auffällig günstige Netzteile können dagegen die Ursache für schwer abzugrenzende Systemabstürze sein. Meistens liefern solche Netzteile keine sehr gleichmäßigen Spannung und können Lastspitzen schlecht ausbügeln. Beim Netzteil den letzten Euro zu sparen halten wir daher nicht für empfehlenswert.
Wer seinen Rechner selber zusammenschraubt (oder auch später oft erweitern will), sollte auch auf die Modularität des Netzteils achten. Hierunter versteht man, ob alle Kabel frei absteckbar (vollmodular) oder teilweise fest mit dem Netzteil verbunden (teilmodular) sind. (Teil)modulare Netzteile sorgen für weniger Kabelsalat im Gehäuse und für besser planbare Strom-Verzweigungen (u.a. für mehrere GPUs).

Beim Kauf von fertig konfigurierten Rechnern mit (teil)modularen Netzteilen, sollte man außerdem darauf achten, dass der Händler die nicht verbauten Kabel separat mitgeliefert. Sonst müssen diese bei späterem Bedarf als teure "Ersatzkabel" separat nachgekauft werden. Natürlich sollte man aus dem selben Grund ungenutzte Kabel auch für die Lebenszeit des Computers an wieder auffindbarer Stelle aufbewahren.
Gehäuse
Bei der Gehäuse-Auswahl entscheidet der persönliche Geschmack wohl mehr, als bei allen anderen Komponenten. Tatsächlich ist die Auswahl hier fast unüberschaubar groß. Wer jedoch klare Vorstellungen von seinem zukünftigen Nutzerverhalten hat, der kann die Auswahl schnell sinnvoll einengen.

Zuallererst wird das Gehäuse vom eingesetzten Mainboard bestimmt. Größere ATX- oder sogar E-ATX-Platinen finden nur in entsprechend geräumigen Gehäusen Platz. Dort ist dann allerdings meistens auch gleich Stauraum für viele interne Laufwerke und gegebenenfalls für ein Einbau von einigen Wechselrahmen. Dies spart den Einsatz externer Festplatten und wer sich einmal an rahmenlose Festplatten-Wechselschächte gewohnt hat, will diesen Komfort selten jemals wieder missen.
Der nächste Faktor ist die Lautstärke. Grundsätzlich lässt sich ein lärmender Rechner auch ohne Nachteile einige Meter vom Arbeitsplatz betreiben, weil man Display- und USB-Anschlüsse auch über längere Kabel nutzen kann. Dennoch kann ein möglichst leiser Betrieb aus diversen Gründen eine hohe Präferenz beim Anwender darstellen. Auch wenn man oft den akustischen Eindruck hat, dass große Gehäuse grundsätzlich lauter sind, muss dies keinesfalls so sein. Sogar das Gegenteil ist der Fall. In großen Gehäusen lässt sich der Luftstrom deutlich besser konzipieren. Hierbei kann man mehr und größere Lüfter verbauen. Bei gleicher Luftfördermenge sind große, langsame Lüfter sind in der Regel leiser, als kleinere, schnell drehende. Dazu staut sich in einem größeren Gehäuse tendenziell weniger Hitze.
Doch auch kleine Gehäuse haben Vorzüge. Vor allem wenn man seinen Rechner an verschiedenen Orten betreibt, ist ein tragbares Gehäuse von Vorteil. Und der Vorzeige-Style-Faktor eines Mac Pro oder ähnlichen Design-Rechnern am Arbeitsplatz ist auch nicht zu verachten, um vor Kunden Eindruck zu schinden.