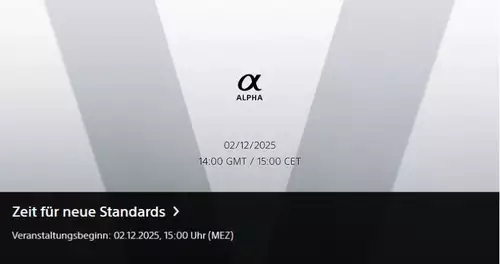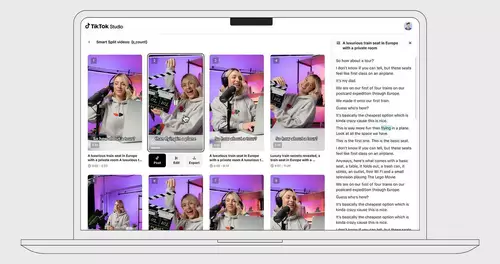Ob Systemkameras, Video-DSLRs, Großsensorcamcorder oder die neuen BMD Cinema Cameras: Videosysteme mit Wechseloptiken erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und damit stellt sich immer öfter auch die Frage, welche Optik zu welcher Kamera passt und welcher Anwendungsfall mit welcher Optik am besten abgedeckt wird. Wir starten auf slashCAM deshalb eine Serie zum Thema "Glas"und beschäftigen uns in den ersten Kapiteln mit der Frage, was eigentlich eine Cine-Optik von einer Foto-Optik unterscheidet. Hier: Skalen und Zahnkränze.
Betrachtet man den Objektivtubus von Cinema-Objektiven im Vergleich zu Foto-Objektiven etwas genauer fallen zwei Unterschiede sofort ins Auge: Die Cine-Objektive schmücken umlaufende Zahnkränze und sie haben deutlich mehr Informationen in Form von Skalen auf der Außenhülle zu stehen.
Zahnkränze
Bei Festbrennweiten sind es zwei, bei Zoom-Optiken drei Zahnkränze die an verschiedenen Stellen um den äußeren Objektivtubus führen. Mit ihnen lassen sich bei Festbrennweiten Blende und Schärfe, bei Zooms zusätzlich noch die Brennweite verstellen.

Die Zahnkränze dienen der Montage diverser Objektivantriebe. Am Fokus-Zahnkranz findet eine Schärfenzieheinrichtung Verwendung, die in den meisten Fällen aus Handrädern mit Übersetzungen bestehen, die die Drehachse des Fokus aus der Kamera Längsachse in die Querachse verlagern. So kann am Handrad ergnomisch optimal die Schärfe kontrolliert geführt werden. Wer mit Nikon oder Leica Optiken an einer Schärfenzieheinrichtung arbeiten möchte, sollte darauf achten, dass sich das Getriebe umschalten lässt.

Hier eine Einsteiger Schärfenzieheinrichtung von Chrosziel
Fokuspuller nutzen zusätzlich zum Handrad an der Schärfenzieheinrichtung eine flexible Welle (Fokuspeitsche) mit einem zusätzlichen Rad am Ende. Diese Welle wird an der Schärfenzieheinrichtung angeschlossen und ermöglicht etwas mehr Abstand zwischen Kamerarig und 1. Kamerassistenten/Fokuspuller: also quasi eine mechanische Fernbedienung.
Am Zoom-Zahnkranz und an der Blende wird häufiger mit Antrieben gearbeitet, die einen Hebel statt einem Handrad nutzen. Bei besseren Zoomantrieben ist die Übersetzung in sich auch noch einmal gedämpft (häufig fluid) um möglichst sanfte, gleichmässige Objektivansteuerungen zu ermöglichen.
Wer sich gerade Gedanken über die Anschaffung von Objektivantrieben macht, dem würden wir in der Reihenfolge der wichtigsten Antriebe folgende Empfehlen: 1. Schärfenzieheinrichtung, 2. Zoomantrieb 3. Blende. Ob Objektivantriebe für den Indiefilmer tatsächlich notwenig sind, muss jeder aus seiner eigenen Praxis heraus selbst definieren und dabei im Hinterkopf behalten, dass es mit einem Antrieb allein in den wenigsten Fällen getan ist. Dazu gehören dann auch Leichtstützen, Kameraplatten u.a. was sich schnell zu recht ordentlichen Summen addieren kann und die Kameras auch nicht unbedingt kompakter werden lässt. Tatsächlich arbeiten in der Praxis auch einige Freelancer komplett ohne Objektivantriebe, mit der Hand an der Optik ...
Wer das ganze elektronisch und remote betreiben möchte, z.B. weil die Kamera auf einem Kran montiert wurde, greift zur Funkschärfe, die meistens die Ansteuerung von bis zu drei Stellmotoren erlaubt, die Blende, Zoom und Fokus getrennt kontrollierbar machen.
Skalen
Im Gegensatz zu den häufig nicht mehr existenten Skalen an modernen AF-Objektiven für die Fotografie, kommt den Skalen auf manuellen Filmobjektiven eine besondere Bedeutung zu. Sie kommunizieren allen Beteiligten die aktuellen Fokus- , Belichtungs- und Brennweiten Werte.

Da der 1. Kameraassistent bei der Kamerabedienung häufig eher neben als hinter der Kamera steht, sind die Skalen für Blende, Fokus und ggf. Brennweite bei den meisten Cine-Optiken so angebracht, dass sie von der Seite – häufig von beiden Seiten - abgelesen werden können (im Gegensatz zu den Skalen manueller Fotooptiken, die von oben abzulesen sind).
Entfernungsmarkierungen für komplexere Schärfeverlagerungen werden häufig auf der weissen Markierscheibe des Follow-Fokus (Schärfenziehvorrichtung) beschriftet, die dann im Verlauf der Aufnahme „abgefahren“ werden.
Hyperfokale Schärfenangaben auf den Optiken treten in der Filmpraxis häufiger zu Gunsten von Schärfentiefentabellen zurück, die von den meisten Herstellern für ihre Cine Optiken angeboten werden oder je nach Bedarf selbst erstellt werden. Moderne Cine-Objektive geben teilweise auch elektronische Metadaten Timecode-gesyncht nach außen weiter, so dass hyperfokale Distanzen in Echtzeit abgelesen werden können (z.B. Arris LDS / Lens Data System von Arri oder die i-Objektive von Cooke).
Um sowohl in der europäischen als auch außereuorpäischen Filmwelt zu funktionieren, lassen sich die Fokusskalen bei einer Reihe von Filmobjektiven relativ einfach von Meter- zu Feet-Angaben wechseln oder beinhalten bereits beide Entfernungsangaben auf parallelen Skalen.
Weiter geht es demnächst beim Thema Cine-Optiken vs Foto-Objektive mit den Kapiteln:
Objektivdurchmesser, Modifikationsmöglichkeiten von Foto-Optiken, dem berüchtigten „T“ vs „f“, Kompatibilität, Auflagenmaß u.a.