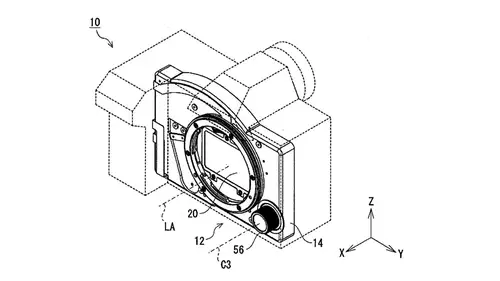Vielleicht begann alles mit Helene. 2013 im Mai war mein Film über Helene Fischer fertig, den ich für die ARD gedreht habe. Ein Jahr andauernde Übung in Diplomatie lag da hinter mir. Die Aufgabe war, der paradoxen Konstellation, einen Film über eine Geschäfsfrau machen zu wollen, deren maßgebliche Aufgabe darin besteht, das eigene Image zu kontrollieren, Szenen abzutrotzen, die einen ernstzunehmenden Film begründen können. Ob das gelungen ist, mögen andere beurteilen. Fest steht, dass ich nicht nur total ausgelaugt war, sondern die Sehnsucht aufkam, in Zukunft nicht mehr nur im Direct-Cinema-Style zur Fliege an der Wand zu werden und dabei quasi selbst zu verschwinden, sondern im Gegenteil mal rauszulassen, was bei mir los ist, ohne auf neue Helenes Rücksicht nehmen zu müssen.
Von der Kamera...
Der erste Schritt war, als Nächstes einen Film über einen Toten zu machen. Der kann keine Änderungswunschliste mehr vorlegen, die man in vierstündiger Telefonkonferenz bis ultimo abwehren muss. Aber das ist eine andere Geschichte.
Der zweite, gewagtere Schritt war das Ergebnis der Verkettung einer vagen Erinnerung mit einem Zufall. Für das Porträt über den Toten machte ich ein Crowdfunding. Bedingung der Plattform: Ich muss im Vorstellungsvideo selbst vor die Kamera. Die Crowd soll schließlich wissen, wem sie ihr Geld anvertraut. Ich weiß nicht mehr, wie viele Takes ich gedreht habe, weniger aus Eitelkeit, sondern weil ich so steif war, dass meine Crowd mir wahrscheinlich eher einen Physiotherapeuten vorbeigeschickt hätte, als mich finanziell zu unterstützen. Und da erinnerte ich mich, dass ich als Jugendlicher mit einiger Begeisterung geschauspielert hatte. Nur, wo war diese Lockerheit geblieben?
Nun gehört zu meinem Bekanntenkreis ein unter Schauspielern gut bekannter Mann, selbst Schauspieler aber auch Schauspiellehrer. Ich kannte ihn noch aus Filmhochschulzeiten, aber erst ein gemeinsamer Freund brachte uns Weihnachten 2015 an einem Kneipentisch wieder zusammen. Gelegenheit für mich, ihm halb im Suff, halb im Spaß zu sagen, dass ich vielleicht mal eines seiner Schauspielseminare besuchen müsse, um wieder locker zu werden. Vier Monate später kam die Einladung. Nach einigen Zweifeln habe ich sie angenommen. Was das bedeutet hat, ist wieder eine andere Geschichte. Aber sie hat mich dahin gebracht, von wo ich eigentlich erzählen möchte, nämlich vor die Kamera.
...vor die Kamera
Ein weiterer Freund wusste von meinem jüngsten Hobby und leitete mir ein Facebookgesuch für einen männlichen Schauspieler weiter. Profil: Vater, Ehemann der Hauptfigur, in seinen Vierzigern, und als Geschäftsmann tätig. Ich bewarb mich und wurde zum Casting eingeladen. Zweistufig, erstmal Leseprobe. Obgleich ein NoBudget-Film, nahm die Gruppe internationaler Filmschaffender, die sich für dieses Projekt zusammengefunden hat, die Arbeit sehr ernst. Und die Szene, die ich für das Vorsprechen einstudieren sollte, erschien mir auch gut geschrieben. Es ging zur Sache. Die Ehefrau kommt nach Hause zurück, nachdem sie den siebenjährigen gemeinsamen Sohn in einem Geschäft allein zurückgelassen hat und der Verkäuferin ihr Telefon hingelegt, die Nummer vom Ehemann schon wählend. Es kommt zum Krach und schließlich zu Handgreiflichkeiten, die für meine Rolle schlechter ausgehen.

Das erste Vorsprechen hatte ich gut hinter mich gebracht. Ich war ganz schön nervös gewesen. Wie beantwortet man die Frage nach der Schauspielerfahrung, wenn man quasi keine hat? Ich wurde zum zweiten Casting eingeladen. Diesmal sollte ich mit der bereits für die Hauptrolle besetzten Schauspielerin die Szene spielen. Sie war ein echter Profi, ich habe alles gegeben.
Wenig später kam die Email, dass sie mit mir drehen wollen. Zwei Tage in zwei Wochen. Ich sagte zu und sogar lukrative Kamerajobs ab, nur weil ich es jetzt wissen wollte. Ich war gespannt und aufgeregt und irgendwie unterschied sich dieser Zustand erheblich von dem, was ich vom Drehen hinter der Kamera kenne. Auch da gibt es Nervosität. Aber beim Helene-Film zum Beispiel habe ich selbst gedreht, und da gibt es allein mit der Kamera soviel, an dem man sich zugleich festhalten kann, dass der freie Fall, den kreatives Arbeiten immer bedeutet, bereits abgefedert wird.
Fordernde Szenen im Drehbuch
Dass der nun auf mich zukommende Fall nicht weich sein würde, war mir spätestens klar, als ich das restliche Drehbuch und damit meine anderen Szenen zu lesen bekam, zwei Tage vor Dreh. Da blieb es nicht bei dem bereits probierten Krach, nein, es kam eine deutlich delikatere Szene hinzu. Ich sollte spielen, wie ich meine Ehefrau nachts, nachdem ich betrunken nach Hause komme und mir bei einer anderen, mit der ich gerne ins Bett gegangen wäre, offensichtlich eine Abfuhr eingehandelt hatte, gegen ihren Willen zum Sex nötige. Puh. Really? I mean are you serious?
Am Set wurde natürlich Englisch gesprochen. Außer der Hauptdarstellerin, „unserem" Kind, der Wohnungsbesitzerin, die uns bei sich drehen ließ, und mir waren alle aus dem Team vom ganzen Globus: USA, HongKong, Südafrika, Frankreich, England, Spanien, Italien, Türkei, Australien, Finnland, kein Scherz.
He was serious. Nun gut. Wie bereitet man sich auf so eine Szene vor, wenn die gefragte Handlung nicht zum eigenen Erfahrungshorizont gehört? Wie kann ich mich in die Motivation eines Mannes hineinversetzen, der ohne Rücksicht auf Verluste seine eigene Frau gegen ihren Willen als Sexobjekt missbraucht?
Glücklicherweise sollte diese Szene erst ganz zum Schluss gedreht werden, am Ende des zweiten Tages. Ich hatte also ein bisschen Zeit, Erfahrungen zu sammeln, vor der Kamera. Aber auch das war schon eine Herausforderung. Da ich so vertraut war mit allen Abläufen hinter der Kamera, Auflösung, Kamera einrichten, Lichtaufbau, Ton, fühlte ich mich eigentlich wie zum Team gehörig.

Allerdings änderte sich das schlagartig, als die erste Szene gedreht werden sollte. Es gab für mich jetzt keine andere Aufgabe mehr, als den Ehemann zu verkörpern, der morgens zur Arbeit geht und seiner Frau erklären muss, dass er nicht wie verabredet abends auf den Sohn aufpassen könne, denn er hätte eine Telefonkonferenz. Morgendliches Chaos, die Mama im Bad, der Sohn bettelt um Pfannkuchen, der Vater, also ich, ist spät dran, bindet sich die Schuhe, den Schlips und muss meiner Frau mit Charme mein offenbar zum wiederholten Male vorkommendes Vergessen meiner familiären Pflichten verkaufen. Die Szene lief ganz gut. Der Junge, war lustig und es hat Spaß gemacht, diese kleine Familie zu impersonalisieren.
War ich gut?
Aber schon da habe ich gemerkt, dass ich keinerlei Kompass habe, ob das, was ich da jetzt gespielt habe, irgendwie gut war. Es gab zwar so ein vages, diffuses Gefühl, dass es irgendwie ok gewesen sein könnte, und auch dafür, was vielleicht noch besser zu machen sei. Aber irgendwie verliert man komplett das Bewusstsein für das eigene Sein. Während es mir im normalen Leben so geht, dass ich mir wenigstens einbilde, einigermaßen zu wissen, was ich tue und wie ich dabei wahrscheinlich wirke, und das ja auch benutze, um Situationen zu meistern, ging mir das hier auf einmal ganz anders. Aber warum?
Im normalen Leben bin ich permanent damit beschäftigt, so etwas wie Identität zu konstruieren oder tue es einfach, allein schon dadurch, dass es ja gewisse Kontinuitäten gibt, also Handlungen, die zu anderen Handlungen führen, sich so etwas wie Geschichte bildet.
Aber hier war ja alles, was das hätte sein können, ausgedacht. Ich bin weder Ehemann, noch habe ich Kinder. Auch glaube ich von mir, mich nicht wie ein Arschloch zu verhalten. Dennoch musste ich das jetzt sein, in meinem Körper mit meiner Stimme. Und wenn ich so darauf schaue, wundert es mich auch gar nicht mehr, dass ich so abhängig davon war, was der Regisseur sagen würde. War es gut? War ich gut? Ja, alles gut. Ok, schön, er war zufrieden. Wie gesagt gab es Momente, in denen ich während des Spielens irgendwie sicherer war als in anderen. Das sind die, in denen ich etwas so schwer Greifbares wie wirklichen Kontakt gespürt habe zu meiner „Ehefrau“ und meinem „Sohn“.

Was ich glaube vom Schauspiel verstanden zu haben, ist, dass man tatsächlich nicht darstellt, sondern zu der Figur wird in dem Moment. Und da beginnt das, was den Unterschied zu hinter der Kamera so riesig macht.
Dort bin ich safe, kann mich immer wieder in meine privaten Gedanken zurückziehen, habe ein Instrument, ein Medium, mit dem ich vermittle zwischen mir als Person und dem wie auch immer gearteten künstlerischen Ergebnis. Sei es eine Lampe, die ich anschalte, Make-up, das ich auftrage, ein Mikrofon, mit dem ich aufzeichne, oder eine Kamera, die ich einrichte und bewege.
Kein Rückzugsraum vor der Kamera
Beim Schauspielen bin ich selbst das Medium. Und ja, das ist verwirrend. Und irgendwie auch ein bisschen gestört. Godard hat Schauspieler, glaube ich, als liebenswerte Kranke bezeichnet. Und doch ist die ursprüngliche Krankheit vielleicht nicht das, was man Schauspielern gemeinhin als Klischee unterstellt, nämlich Egozentrismus. Ganz so einfach ist es nicht. Diese Zuschreibung, die ich selbst oft genug gedacht habe, bevor ich den Seitenwechsel erlebte, ist, glaube ich, oft nur ein Ausdruck von Ängsten vor der eigenen Courage oder entsprechend Neid vor der Courage der anderen. Denn eines muss man als Schauspieler tun, und zwar nicht aus klinischen Gründen, sondern weil es die Aufgabe, ja die Verantwortung dieser Arbeit ist: man muss sich zeigen. Etwas zurückhalten, das funktioniert nicht.
Auch das durfte ich erfahren. Bei der zweiten Szene, die wir gedreht haben, passierte mir, wovor ich Angst hatte, ohne es zu wissen. Ich ließ mich anstecken vom Streß des Sets, wir waren im Verzug, und es sollte alles schnell gehen. Daher probten wir die Szene nicht und es sollte gleich gedreht werden. Dann klappte es nicht. Ich fand nicht hinein in das, worum es dem Regisseur für meine Figur ging. Und ich war nicht flexibel genug, von dem, was ich mir zurechtgelegt hatte, Abstand zu nehmen und für mich zu übersetzen, was er mir als Anweisung gab. Die Folge war eine Blockade, die dazu führte, im Kopf eine Lösung finden zu wollen. Nur führt das, und das wiederum habe ich ganz klar gespürt, dazu, nicht mehr zu spielen sondern tatsächlich darzustellen. Ich habe versucht, das zu machen, was der Regisseur von mir sehen wollte. Aber eben bewusst, indem ich gleichzeitig darüber nachdachte, was jetzt wohl das Richtige zu tun, wie der Satz richtig zu betonen sei. Dabei kam nichts raus, was sich für mich auch nur annähernd wie gutes Schauspiel anfühlte. Eher kam ich mir vor wie eine Kasperlefigur, ein fremdgesteuertes Objekt.
Noch schlimmer war, dass der Regisseur sich irgendwann zufrieden gab, es war schließlich keine entscheidende Szene, meinte er, und mit der Hauptdarstellerin zum Rauchen verschwand. Wow, wäre es nicht so irritierend gewesen, hätte ich laut auflachen müssen, so sehr fühlte ich mich wie ein verlassenes Kind in dem Moment, das eifersüchtig auf die Zuwendung zur anderen reagiert und zugleich wütend auf diese Unverschämtheit. Da war also noch eine neue Dimension ziemlich purer Gefühlsenergie, die ins Spiel kam: Befindlichkeiten in kindlicher Reinform. Nicht schlecht.
Das Vertrauen zur Regie ist essentiell
Ich fand meinen Abstand, ging hin und schon sprachen wir über die gemeinsame Frustration. Nur besser hat es das für mich auch nicht gemacht. Der Makel blieb ja, ich hatte versagt. Jedenfalls in meinen Augen. Gleichzeitig kam ich mir albern und hysterisch vor. Aber ich wollte es doch nur gut machen. Ein weiterer Aspekt, der anders ist auf dieser Seite. Während hinter der Kamera, auch wenn es schändlich ist, schon mal die Haltung von „versendet sich“ auftauchen kann, ist das vor der Kamera kaum denkbar. Dafür ist der Druck zu groß.
Oder wollte er mir gerade genau das sagen, das sich es nicht zu ernst nehmen soll? Aber was hätte das bedeutet? Dass er seinen Film nicht ernst nimmt, und damit uns Schauspieler auch nicht? Wofür also verausgaben wir uns hier, emotional? Nein. Er fing es einigermassen auf, warb um mein Vertrauen und konnte es zurückgewinnen.
Ein weiterer, wenn nicht überhaupt der essentielleste Aspekt: das Vertrauen zur Regie. Ohne das geht gar nichts. Jedenfalls nicht bei mir. Und wie im richtigen Leben, nur irgendwie in Zeitraffer, ist das kein statischer Deal, einmal gemacht, sondern ein permanentes Ringen und Kämpfen.
Dabei lernte ich auch, wenngleich ich das erst später formulieren konnte, dass es als Schauspieler, der vor die Kamera tritt, für den, zugespitzt gesagt, alle anderen arbeiten, meine Verantwortung ist, alles für die bestmöglichen Bedingungen meiner Arbeit zu tun aber eben auch einzufordern. Dieses "Sich-Wichtig-Nehmen" als Arbeitender, bei dem eben nichts sich versendet oder irgendwie nachträglich dran drehen lässt, war für mich wirklich eine neue Erfahrung. Dienen, in dem man sich maximal wichtig nimmt, so wenig Kompromisse wie möglich macht, das ist eine grundlegende Differenz zur anderen Seite. Und auch sie befeuert natürlich das Klischee, Diva, etc.

Dabei zugleich die Grenze zwischen Arbeit, also Figur, und Privatem, also Schauspieler, nicht aus dem Blick zu verlieren, stelle ich mir als große Herausforderung vor, wenn man diesen Beruf länger ausübt. Und vor diesem Hintergrund machten für mich auf einmal auch die ganzen Diskussionen oder Bemühungen um Techniken des Schauspiels Sinn. Wie erzeuge ich wahrhaftige Emotionen, ohne nachher darauf hängenzubleiben? Früher, so habe ich kürzlich erfahren, wurden Schauspieler gesetzlich zwei Stunden vor und bis zwei Stunden nach ihrer Aufführung als nicht zurechnungsfähig betrachtet. Der Paragraph soll abgeschafft worden sein. Das halte ich für einen Fehler.
Showdown...
Nachdem ich also einige Lektionen bereits erfahren hatte, stand mir die größte Herausforderung mit der Vergewaltigungsszene noch bevor. Zu meiner Erleichterung war der Kamerawinkel fix und so gewählt, dass wir noch nicht einmal unsere Sachen ausziehen mussten. Und außerdem hat der Regisseur vor allem mir, denn sie verblieb eher passiv in der Szene, die Arbeit erleichtert, indem er sie stark rhythmisiert hat. Ich hatte also zumindest ein bisschen eine Struktur von Handlungsanweisungen, an die ich mich halten konnte. Nichtsdestotrotz blieb es eine Herausforderung, denn es war eine lange Szene mit viel Text, bevor es zur Tat kam, die dann sehr genau rhythmisiert ablaufen sollte, und er wollte sie als Plansequenz drehen.

Dass wir bereits seit 15 Stunden drehten und mir wortwörtlich die Augen zuzufallen begannen, mag der Authentizität unserer Spielweise für die nächtliche Szene, in der ich zudem betrunken sein sollte, zuträglich gewesen sein, allerdings war das ein schmaler Grat. Und so hatte ich auch ernsthafte Schwierigkeiten mich beim ersten Take, der abgebrochen wurde, und zweiten an meinen Text und die komplexen Handlungsabläufe in der richtigen Reihenfolge oder überhaupt zu erinnern. Als dann der zweite Take, der dennoch ganz gut gelaufen war, leider nicht voll aufgezeichnet worden war, weil, entschuldigt bitte, der Penner von Kameraassistent nicht darauf geachtet hat, dass noch genug Platz auf der Speicherkarte war, blieb nur noch Kaffee.
Es war ein heikler Moment: Ich war nahe dran, nicht mehr spielen zu können, es war die entscheidene Szene, das Team wollte nach Hause, bis zu letzten U-Bahn war es nicht mehr lang, und vor allem war es der letzte Drehtag in der Wohnung und der Aufwand, alles noch einmal machen zu müssen, wäre enorm gewesen. Auch das also ein Druck, der sich letztenendes beim Schauspieler sein Ventil sucht. Entweder ich bringe es jetzt, oder alles ist am Arsch. Ich exte zwei Tassen kalten Kaffee, der eigentlich Espresso war, und war dem Herzinfarkt nahe, aber so ging es. Einmal haben wir die Szene dann noch gedreht. Und ich hatte noch genug Koffein im Blut, skeptisch zu bleiben. Das soll es gewesen sein?
Was bleibt?
Wie gesagt ist fast nichts schlimmer als das Vertrauen in das Urteil des Regisseurs zu verlieren und doch von ihm abhängig zu sein. Vielleicht beschreibt die Fähigkeit zur Hingabe diesen Beruf am besten.
Die Erschöpfung nach Drehschluß war kaum zu beschreiben. Und der Wunsch, Drogen in Form von Alkohol und Zigaretten zu konsumieren, war übermächtig. Wie auch sonst mit dieser Zumutung umgehen? Eben noch Vergewaltiger, jetzt wieder normaler Mensch unter anderen?
Zu Hause habe ich dann gedacht, wenn ich für diese Arbeit bezahlt worden wäre, hätte ich mich wahrscheinlich wie eine Hure gefühlt. Und nicht umsonst wurden Schauspieler*innen und Schauspieler ja oft in diese anrüchige Ecke gestellt. Laut David Mamet waren sie den Menschen in früheren Zeiten so unheimlich, dass sie nicht auf Friedhöfen, sondern an Wegkreuzungen beerdigt wurden. Ob sie auch noch gepfählt wurden wie die Wiedergänger in Rumänien, habe ich vergessen.
Für mich gibt es aber einen Fehler in der Analogie zur Prostitution. Während diesen immer unterstellt wird, ihre Gefühle nur zu spielen, genauer, vorzuspiegeln, obwohl sie eben nicht da sind, und damit die Imagination in dem Falle beim Freier liegt, der sich geliebt, begehrt uns sonst was fühlt, ist es bei der Schauspielerei anders und vielleicht komplizierter. Die Gefühle müssen echt sein, und das kann nur geschehen, indem die Imagination beim Schauspieler liegt. Auch wenn Regie, Kamera, Schnitt entscheidend zur schließlichen Vorstellung beim Zuschauer beitragen, ist doch ohne den Schauspieler und seine Imagination alles nichts.

Da das unheimlich ist, auch ihm selbst, weil es möglich ist, und weil es Fragen aufwirft auch für alle anderen Bereiche des Lebens, deswegen vermutlich die Abwehr und der Vergleich mit der Prostitution. Und auch die Gefahr, sich in Süchten zu verlieren. Denn die Frage, was ist oder wer bin ich wirklich, ist eine schwer zu ertragende.
Ich habe mehrere Tage gebraucht, mich von den emotionalen Strapazen dieser Arbeit zu erholen. Wäre es nicht so, beruhigte mich mein Kumpel und Schauspiellehrer, wäre ich ein Psychopath. Der bin ich offenbar nicht, Glück gehabt.
Würde ich es wieder machen? Ich denke schon, auch wenn ich zwischendurch gerne die Seite gewechselt hätte. Aber ich möchte wissen, ob mir gelingen kann, was meine Kolleg*innen empfehlen, um Rollen zu spielen, die ihnen fremd sind, nämlich sich zu freuen, dass man Dinge tun darf, die man sonst nicht ohne weiteres machen kann. Ob das allerdings wirklich eine Freude ist, da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall aber habe ich gelernt, wie viel Schauspieler*innen geben. Und das verdient meinen Respekt und meine Nachsicht für die damit einhergehenden Auffälligkeiten. - Wenn ihr mich casten wollt, nur zu, und gerne für eine Komödie!
Kai Ehlers