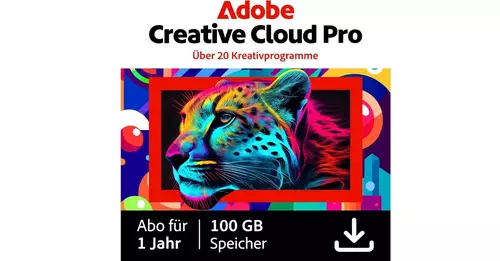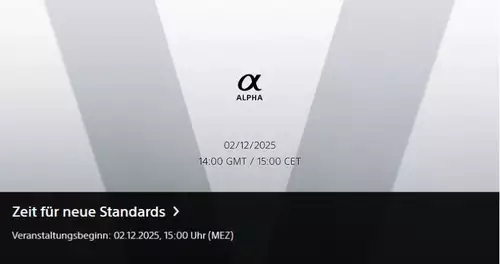In unserem Video-DSLR Workshop wollen wir nach den externen Audiovorverstärkern im Zusammenspiel mit Richtmikros nun das Setup einer Funkstrecke mit einem Lavalier Mikrofon genauer betrachten. Worauf gilt es zu achten, wo liegen die Vor- und Nachteile einer Funkstrecke und welche Tonqualität stellt ein Einsteiger-Set wie das Sennheiser G3 zur Verfügung?

Wer sich mit dem Thema Funkstrecke näher auseinandersetzen möchte, kommt nicht um die Neuregelung des UHF-Frequenzbereiches durch die Bundesnetzagentur vorbei. Hier das Wichtigste in aller Kürze:
Worauf achten bei den Funkfrequenzen?
Durch die Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen (DVB-T) wurden Frequenzbereiche frei, die zuvor für die Fernseh-Übertragung genutzt wurden. Digitaler Rundfunk benötigt in etwa nur 10% der zuvor genutzten Bandbreite. Die frei gewordenen Bereiche (Digitale Dividende) wurden durch die Bundesnetzagentur für andere (Mobil)Funknutzer versteigert. Hierbei tut sich jedoch das Problem auf, dass eine ganze Reihe von Veranstaltungs- und Medientechnik im Frequenzband zwischen 790-814 und 838-862 MHz unterwegs ist und war. Dieser Frequenzbereich steht noch bis 2015 u.a. für Funkstrecken /Drahtlosmikrofone zur Verfügung. Danach ist ein Betrieb hier nicht mehr möglich. Für die Zeit bis 2015 ist mit immer schlechterer Verfügbarkeit dieser Frequenzen zu rechnen.
Professionelle und institutionelle Nutzer können sich gegen Gebühr Nutzungsrechte von Frequenzen für ihr Equipment zuteilen lassen - für Funkmikrofone wurde der Frequenzbereich 710-790 MHz reserviert.
Diese professionelle Nutzergruppen wurden von der Bundesnetzagentur in die Segmente „Professionelle drahtlose Produktion“ (Professionelle Tour- & Medientechnik-Verleiher, Professionelle Bands, Programmproduktionen, Theateraufführungen mobil mit eigenem Equipment, Musicals (auf Tour), Ü-Wagen (privat)), „Rundfunk“ und „Ortsgebundene Nutzung“ unterteilt. Die einmalige Gebühr für die Zuteilungs-Urkunde beträgt 130,-, der jährliche Frequenzschutzbeitrag pro Sender beträgt ca. 10,- Euro. Achtung, wer mehr Sender betreiben möchte, muss diese in der Urkunde vermerken lassen. Eine Änderung der Urkunde schlägt mit 60,- Euro zu Buche. Es lohnt sich daher, mehre Sender gleich von Anfang an zu beantragen und diese erstmal nicht zu nutzen, als später die Urkunde ergänzen zu lassen.
Wer auf kleinerem Niveau unterwegs ist und so wie wir hier eine Lavalier-Funkstrecke mit einem Mikro an einer Video-DSLR nur gelegentlich betreiben möchte, für den dürfte sich die Anschaffung einer professionelle Frequenzzuteilung nicht lohnen. In diesem Fall werden dann die kostenfreien „Allgemeinzuteilungen“ interessant.
Insgesamt drei solcher kostenfreier Frequenzbereiche, die alle bis 2021 garantiert sein sollten, kommen für unsere Funkstrecke in Frage und müssen unbedingt bei der Anschaffung einer neuen Funkstrecke berücksichtigt werden:
863-865 MHz ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band)
823-832 MHz Mittenlücke (Zwischen Up- und Downlinkfrequenzen von Mobilfunknetzen)
1785-1805 MHz
Unsere hier exemplarisch für andere Funkstrecken vorgestellte Sennheiser Funkstrecke ew 100-ENG G3 arbeitet im sogenannten e-Band in einem Frequenzbereich von 823 - 865 MHz und deckt damit sowohl das ISM-Band als auch die Mittenlücke ab.
Einrichtung Funkstrecke
Die Sennheiser ew 100 ENG-G3 Funkstrecke besteht im Set aus insgesamt 4 Komponenten: Dem Taschensender SK 100 G3 mit Gürtelclip, dem Diversity-Empfänger EK 100 G3 inkl. Blitzschuhadapter, dem ME-2 Lavalier Mikro sowie dem XLR-Aufstecksender SKP 100 G3, der für den drahtlosen Betrieb von Handmikros gedacht ist.
Im Folgenden wollen wir kurz die einzelnen Schritte für die Inbetriebnahme der Funkstrecke an der Canon EOS 5D Mark III vorstellen, die hier stellvertretend für den generellen Betrieb von Funkstrecken an Video-DSLRs stehen soll.

Zunächst gilt es vom Empfänger die zur Verfügung stehenden Frequenzen prüfen zu lassen. Dies sollte vor jeder Inbetriebnahme am Drehort geschehen. Auf keinen Fall sollte man sich auf einmal eingerichtete Frequenzen an der Funkstrecke verlassen – ansonsten sind Störungen an Orten wo vielfach Funkfrequenzen genutzt werden, vorprogrammiert. Auch empfehlen wir andere „Funkgeräte“ (Handys, Handfunken etc.) vor Drehbeginn zu deaktivieren – doch dies sollte eigentlich selbstverständlich sein.

Zunächst lassen wir also einen Frequenz-Scan laufen. Diesen findet man im Easy Setup Menü des Empfängers unter dem Menüpunkt „Scan New List“. Hier wird nun ein Scan der Frequenzen zwischen 823 und 865 MHz. gestartet. Der Empfänger meldet sich nach ein ca 1 Minute zurück mit den pro Bank zur Verfügung stehen Kanälen – in unserem Beispiel hat bereits Bank 1 die maximalen 12 Kanäle zur freien Verfügung. Wären hier alle Kanäle belegt, würden wir uns die restlichen Banks anzeigen lassen, bis freie Kanäle zur Verfügung stehen und diese dann auswählen. Insgesamt stehen 20 Banks zur Verfügung mit jeweils maximal 12 Kanälen.

Nachdem wir nun unsere Frequenz am Empfänger bestätigt haben, müssen wir die entsprechende Frequenz auch beim Sender einstellen. Hierfür verfügen die beiden Funkeinheiten über eine Infrarot-Schnittstelle, mit der die Frequenzwahl sehr einfach übermittelt werden kann. Beim Empfänger rufen wir hierfür das Menü „Sync“ auf. Nach dessen Aktivierung halten wir den Sender mit ebenfalls aufgeklapptem Batteriefach in kurzem Abstand an den Empfänger.

Sobald ein Haken hinter dem Sync Text im Display erscheint, ist der Handshake perfekt und die Funkeinheiten können miteinander kommunizieren. Die aktive Funkverbindung wird durch das grüne Leuchten der RF LED am Empfänger angezeigt. In Umgebungen mit viel belegten Frequenzen empfehlen wir die Aktivierung der Pilot Tone Funktion beim Sender, durch die sichergestellt wird, dass keine anderen Funksignale vom Empfänger aufgenommen werden, auch wenn der Sender kurzzeitig ausgeschaltet wird.
Jetzt gilt es das Lavalier-Mikro am Sender einzurichten. Hierzu wird die Miniklinke in den MIC/Line Eingang des Senders gesteckt. Unbedingt hierbei darauf achten, dass die Miniklinke auch mit dem Sender verschraubt wird. Es kann bei der Aufnahme immer mal leichter Zug auf das Mikro-Kabel kommen und nichts ist ärgerlicher als während eines Interviews nochmal am Gesprächspartner rumfrickeln zu müssen, weil die Mikroverbindung zusammengebrochen ist.

Die Empfindlichkeit des Lavaliers lässt sich am Sender unter dem Menüpunkt „Sensitivity“ einstellen. Die Werte reichen hier von -60 dB bis 0 dB. Wir sind gut mit einer Einstellung von -18dB gefahren. Dies kann sich jedoch je nach gewähltem Lavalier und Umgebung deutlich ändern. Für die Aussteuerung des Pegels steht ein AF-Balken im Display zur Verfügung. Am besten man macht hier vor Ort ein Paar Test und achtet darauf, den maximalen Ausschlag irgendwo zwischen der Mitte und dem Maximum zu haben. Eine AF-Peak LED leuchtet bei Clippings auf, die unbedingt vermieden werden sollten. Wir haben mit Werten um -18 dB herum mit dem von uns eingesetzten Lavaliers in unserem Setting ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber hier sollte für jede Umgebung und jeden Sprecher für optimale Ergebnisse neu gepegelt werden.

Als nächstes steht das Pegeln der Output Lautstärke des Mikrofonsignals am Empfänger an, nachdem auch hier mit einem verschraubbaren Mini-Klinken-Kabel der Empfänger mit der Mic-In der Video-DSLR verbunden wurde. Da unterschiedliche Video-DSLRs über unterschiedlich empfindliche Eingänge verfügen sollte auch hier stets individuell gepegelt werden. Darüber hinaus ist die Output-Lautstärke am Empfänger auch von der zuvor eingestellten Sensitivity an der Sender-Seite anhängig. Das ganze System muss also in der optimalen Balance gehalten werden. An der Canon EOS 5D Mark III haben wir beim Empfänger unter dem Menüpunkt AF-Out hierfür einen Wert von +6 dB gewählt. Der finale Pegel sollte dann am Pegelausschlag der Video-DSLR kontrolliert werden.

Neben dem AF-Out-Signal verfügt der Empfänger auch über eine Squelch-Funktion. Mit Squelch wird der Ausgang des Receivers gemutet, bis eine bestimmte Signalstärke erreicht wird – vergleichbar in der Funktion mit einem Noise-Gate. Wir haben das Squelch Menü stets auf Low stehen und bislang noch keine Situationen gehabt, in denen wir hier etwas hätten ändern müssen. Bei extrem lauten Umgebungen kann jedoch eine andere Squelch-Funktion (Middle oder High) durchaus angebracht sein.
Lavalier Mikrofone
Lavalier Mikrofone sind Kondensatormikrofone, die meistens mit einer Kugelcharakteristik aufnehmen. Nieren und Supernieren werden bei Lavaliers gerne für sehr laute Umgebungen genutzt. In Einsteiger-Sets wie dem von uns hier vorgestellten Sennheiser ew 100 ENG-G3 sind meistens Lavaliers mit Kugelcharakteristik dabei.

Der große Vorteil von Lavaliers mit Kugelcharakteristik ist ihre relative Unempfindlichkeit gegenüber der Blick- und damit auch der Sprachrichtung des Sprechers. Selbst Sprecher, die während des Interviews ihren Kopf viel drehen (um bsp. etwas zu erklären oder an einem Model zu veranschaulichen) werden von dem Kugel-Lavalier meistens gut abgedeckt.
Einmal gut am Revers des Sprechers angebracht kann sich dieser frei innerhalb des Radius der Funkstrecke bewegen. Ein Angeln wie bei einem Richtmikro entfällt. Damit empfiehlt sich die Kombination Funkstrecke und Lavalier-Mikro ganz besonders für kleine oder One-Man Crews. Die Verstärker-Leistung der hier vorgestellten Funkstrecke konnte uns jedenfalls für die in diesem Workshop skizzierten Anwendungsfälle: Industrie- Event- oder Reportagefilm überzeugen. Sowohl was die Verstärker-Leistung als auch das Handling in der Interviewsituation anbelangt.
Die bestmögliche Platzierung des Lavaliers hängt häufig von der Kleidung des Interviewpartners aber auch von dessen Stimme und genutztem Lavaliers-Typ ab. Manche Lavaliers funktionieren besser möglichst nah am Sprecher, andere haben einen besseren Dynamikumfang bei etwas mehr Abstand. Grundsätzlich würden wir darauf achten, das das Mikrofonkabel mindestens mit einer Schlaufe am Clip versehen ist, so dass etwas Spielraum für Zuglast am Kabel ist. Auch die Verklebung des Kabels auf der Innenseite von Kleidung mit medizinischem Tape hat sich durchaus bewährt.
Hörproben
Wir haben in zwei Lavaliers an der Sennheiser Funkstrecke einmal hineingehört und unter gleichen Bedingungen wie zuvor die Richtmikros an der Canon EOS 5D Mark III aufgenommen.

Zum Einsatz kamen das bei der Funkstrecke von Sennheiser mitgelieferte Ansteckmikrofon ME 2 sowie das Rode Lavalier – beide Mikros mit Kugelcharakteristik. Das Rode ist im Vergleich zum Sennheiser mit knapp 200,- Euro deutlich teurer und wird häufig als sehr rauscharmes Upgrade zum ME 2 gehandelt.
Wir haben die beiden Lavalier Mikros an der Funkstrecke in unser kleines Vergleichsvideo mit aufgenommen, so dass sich hier nun eine Reihe von Mikrofonen als erste Orientierung im Vergleich hören lassen. Zu hören sind hier: Das Sennheiser ME 2 sowie das Rode Lavalier an der Sennheiser Funksstrecke, das Sennheiser MKE 600 und das Rode NTG-2 an unterschiedlichen Audiovorverstärkern und das Ganze stets am Mikrofoneingang einer Video-DSLR - in diesem Fall der Canon EOS 5D Mark III:
Gut ist im Vergleich zu hören, wie wenig Raumeindruck die Lavaliers mit ihrer Kugelcharakteristik aufnehmen. Dafür ist die Dynamik im Vergleich zu den Richtrohren weniger ausgeprägt. Vor- und Nachteile liegen hier also recht nahe beieinander. Hier dürfte jetzt auch klar werden, welche Art von Mikro wir im vorangegangenen Teil dieses DSLR-Workshops genutzt hatten, um dem halligen Büroraum entgegenzuwirken: Es handelte sich ebenfalls um ein Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik, in diesem Fall um ein dynamisches Handmikrofon mit Kugelkapsel: Das Rode Reporter.
Fassen wir nochmal kurz zusammen, in welche Mikros für den Reportage/ Industriefilmeinsatz wir bis dahin hineingehört haben: Das interne Mikro der Video-DSLR, Richtrohrmikrofone, dynamische Handmikrofone sowie Lavaliers.
Demnächst stellen wir den Einsatz der Video-DSLR in einer echten Interviewsituation unter verschärften Bedingungen als One-Man-Operator inkl. LED-Lichtaufbau und Kamerabedienung vor und auch einige populäre externe Audio-Recorder wollen wir uns demnächst in dieser Video-DSLR-Reihe noch etwas genauer anschauen.