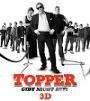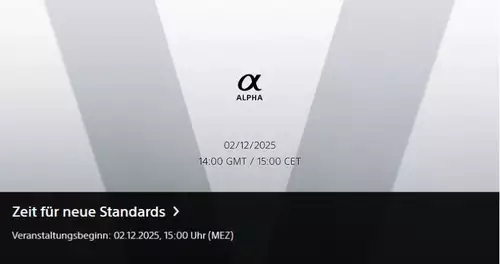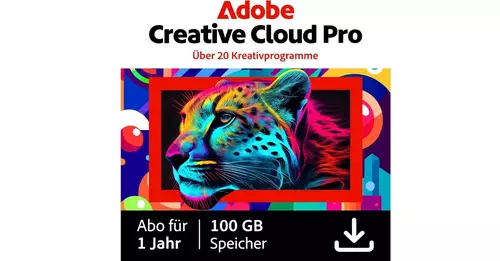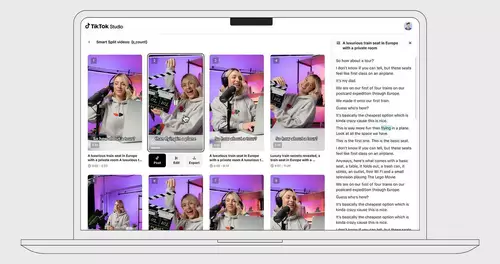"Topper gibt nicht auf" ist der erste an einer Filmhochschule (HFF „Konrad Wolf“) gedrehte, stereoskopische Realfilm, das heißt, anders als bei Up oder Avatar gibt es keine gerenderten Bilder zu sehen. Statt dessen wurde ausschließlich Echtbild-Material aufgenommen, und zwar mit zwei Sony EX3-Camcordern in einem P+S Spiegelrig. Aufgezeichnet wurden die parallelen Bildströme mit einem Codex Recorder (JPEG2000), daraufhin sowohl auf einem Server als auch Clipster gesichert; letztere stellte dann auch das Material als DPX-Dateien für die Postproduktion am Avid DS bereit. Der Schnitt dauerte etwa zwei Monate, ganze acht TB an Daten kamen übrigens für das Projekt zusammen -- allerdings ist der Film am Ende auch 25 Minuten lang statt der geplanten 10 geworden.

Kontrolle
Gedreht wurde der Film, der selbstreferentiell von einem Filmdreh handelt, passenderweise komplett in Studioumgebung, auch um die Produktionsbedingungen besser kontrollieren zu können – denn bei der 3D-Filmerei scheint just vor allem dieses eine Hauptrolle zu spielen: Kontrolle. Damit die stereographischen Bilder ihre Wirkung entfalten können, müssen sie technisch einwandfrei und die Raumdarstellung wohlüberlegt und -berechnet sein.
Um die passende Stereobasis, dh. den Abstand zwischen den zwei Kameras, zu ermitteln, mußte jede Einstellung eingemessen werden, denn die Stereobasis ist abhängig von der Brennweite und der Tiefe des zu erzählenden Raumes: welches Objekt ist am nächsten an der Kamera bzw. am weitesten weg, und wie sollen die Bildinhalte auf der Leinwand gestaffelt werden. Ein anderes Thema wäre die Konvergenz, sie bestimmt welche Bildebenen jeweils als vor oder hinter der Leinwand liegend wahrgenommen werden. Diese kann (und wurde in diesem Fall wohl auch) nachträglich mit einem sogenannten Depth Grading in der Postpro verändert werden.

Ferner ist es wichtig, daß die zwei Kameras im Spiegelrig exakt synchron aufnehmen. Tun sie dies nicht, liegt eine sogenannte Disparität vor – einer der möglichen Auslöser der berüchtigten Kopfschmerzen bzw. Übelkeit beim Zuschauer, da dieser die Unebenheiten zwischen dem rechten und linken Bild ausgleichen muß. Sowohl Bildausschnitt und Brennweite als auch der Fokus, Belichtung uä. müssen identisch eingestellt sein, und selbst dann werden in der Postpro noch Korrekturen fällig (sog. Sweetening), da es selbst zwischen baugleichen Kameras Varianzen zB in der Optik gibt.
Um die Korrekturen nachträglich einigermaßen automatisieren zu können, wurden beim Dreh von Topper mit Hilfe eines abgefilmten, gerasterten Testcharts die Camcorder im Spiegelrig vor jedem Take bei Stereo=0 kalibriert. (Übrigens: obwohl die Bilder also sorgfältig in der Postproduktion korrigiert wurden, stellten sich bei zwei von zwei slashCAM-Redakteuren während der Filmvorführung leichte Kopfschmerzen ein... )
Besondere Ansprüche werden bei 3D-Aufnahmen auch an das Licht gestellt. Beispielsweise können Reflexionen häufig Probleme bereiten, weil nur die eine Kamera ein Blitzen sieht, die andere jedoch nicht: ein irritierendes Flimmern ist die Folge ("stereoskopischer Glanz"). Aufgrund der Studiosituation konnte das Licht in diesem Fall relativ leicht gezähmt werden, nur selten einmal kommt es an einzelnen Bildteilen zu einem kurzen Flackern.
Kreativität
Auffällig sind die kreativen Einschränkungen, die das stereographische Drehen bedingt. Da wie oben geschildert für jeden Take die passende Kameraeinstellung ermittelt werden und diese dann penibel synchron vorgenommen werden muß, sind der Spontanität äußerst enge Grenzen gesetzt: jeder Take wurde folglich bei „Topper gibt nicht auf“ im Vorfeld akribisch geplant. Mit Frameforge wurden die Einstellungen prä-visualisiert: die Räume virtuell nachgebaut, und ermittelt, welche Brennweite benötigt und wo die Kamera platziert wird.

Jede Bewegung der Kamera mußte geplant und durfte auch nicht zu schnell sein, mal abgesehen davon, daß sich mit dem etwas klobigen Spiegelrig beispielsweise Steadicam-Fahrten nur umständlich bewerkstelligen lassen. Auch bei der Wahl des Bildausschnitts gelten andere Gesetze als bei der 2D-Produktion. Um die räumliche Illusion nicht zu stören, sind etwa angeschnittene, "spannungserzeugende" Kadrierungen tabu (sonst gäbe es eine sog. „window violation“). Statt dessen werden gerne tiefenbetonende Objekte im Vordergrund des Bildes platziert, wie etwa hier das runde, alte Mikrophon:

Doch nicht nur die Regie und Kamera, auch die Schauspieler waren als Folge eingeengt in ihrem Handlungsspielraum (im wahrsten Sinne des Wortes). Bodenmarkierungen zeigten ihre exakt einzunehmenden Position in jeder Szene; spontane Zwischenschritte oder Armbewegungen: unerwünscht.
Die Kosten- / Nutzenfrage...
Bleibt also die Frage, ob sich lohnt, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, um ein Projekt in 3D zu realisieren – allerdings nicht in diesem Fall, denn der Film wurde im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten 3D-Forschungsprojektes PRIME realisiert, und war von anfang an als „Showcase“ angelegt. Dadurch hatten die Studenten nicht nur Zugang zu neuester Technik, auch standen dem Regisseur Félix Koch und seinem Team jede Menge fachkundige Hilfe zur Seite, beispielsweise vom Fraunhofer HHI -- beides ohne das Budget zu belasten. Dieses belief sich dadurch nur auf ca. 25.000 Euro anstelle einer höheren Summe im 6-stelligen Bereich. Generell schätzen die Produzenten, daß etwa 25% Mehrkosten bei einem Großprojekt (30-40% bei kleinen Projekten) bei stereoskopischem Produzieren einkalkuliert werden müssten – unter anderem auch, weil das Drehen aufgrund des aufwändigem Einrichten der Kameras länger dauert.

Für uns war es auf jeden Fall sehr interessant, stereoskopische Echtbilder auf großer Leinwand zu sehen, vor allem auch da es sich um recht „natürliche“ Aufnahmen handelt, verglichen mit dem üblichen 3D-Effektkino. Wie oft betont wird, müssen ja bei 3D nicht nur die Filmemacher, sondern auch das Publikum dazulernen, da eine andere Orientierung in den Filmbildern nötig ist; unsere Beobachtungen zum Film sind also gezwungenermaßen subjektiv (und möglichweise konservativ..). So haben uns beispielsweise vor allem jene Einstellungen sehr gut gefallen, die der Leinwand einen Relief-Charakter verleihen (etwas ragt hinaus, anderes hinein) – sie verleihen dem Film ein scheinbar haptisches Moment, das die Gesamtillusion nicht stört. Größere Kamerafahrten dagegen können unserer Meinung nach leicht den Raumeindruck sprengen, wenn sich Dinge plötzlich in Luft auflösen, bevor sie an einem vorbeiziehen konnten. Reine Gewohntheitssache? Gut möglich, die Zeit wird es zeigen... Ebenfalls nicht so ganz leicht ist es mit den langen Brennweiten: wir hatten bei einigen Einstellungen beinahe das Gefühl, eine Rückprojektion zu sehen, so krass erschien uns der Sprung zwischen den vorderen und hinteren Bildebenen.

Während man bei einer Echtbild-Produktion also permanent aufpassen muß, sich im Rahmen einer realistischen Raumdarstellung zu halten (sofern eine solche -- zum Wohle des Betrachters -- angestrebt ist natürlich), damit Abweichungen nicht als Fehler wahrgenommen werden, hat man bei Animationen dagegen freie Hand. Das wird schön sichtbar bei sowohl Vor- als auch Nachspann des Films: hier wirbeln die Objekte und Perspektiven nach Herzenslust durcheinander, was im Vergleich zum zwangsläufig eher statischen Film ziemlich befreit wirkt.
Für uns zumindest lautet das Fazit: 3D kann auch im Realfilm durchaus eine ästhetische Bereicherung sein, denn es lassen sich tatsächlich sehr interessante Filmbilder mit der Stereoskopie produzieren. Wir sind daher gespannt auf weitere Versuche, insbesondere auch auf Experimente, wie sich der neue „Filmraum“ narrativ und kreativ nutzen lassen kann. Dennoch ist es nach wie vor absolut entscheidend, daß auch die anderen Parameter des Produktion stimmen: Drehbuch, Regie, Casting – denn 3D ist ja kein Ersatz für eine gute Geschichte. Obwohl also eine erhebliche, technische Mehrarbeit auf ziemlich unbekanntem Territorium geleistet werden muß, sollte man darauf achten, genug Sorgfalt auch für die übrigen und üblichen Aufgaben bei der Filmproduktion aufzubringen.
Mehr Infos zum Film hier – unter anderem gibt es zahlreiche Interviews mit der Crew sowie ein aufschlussreiches Werkstattgespräch.
Wer sich für 3D interessiert und auch gerne Echtbildaufnahmen sehen möchte, kann übrigens bei Moviac.de „Topper gibt nicht auf“ als Wunschfilm markieren. Finden sich genug interessierte in einer Region, läßt sich möglichweise ein Kinobetreiber überreden, den Film einmal vorzuführen.