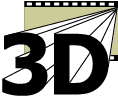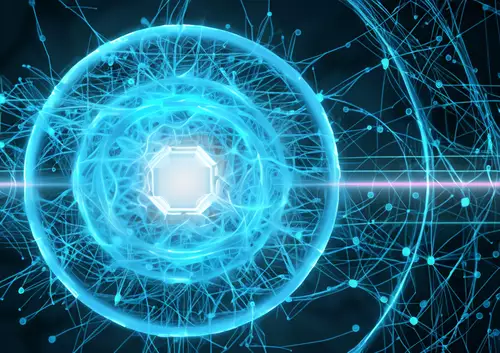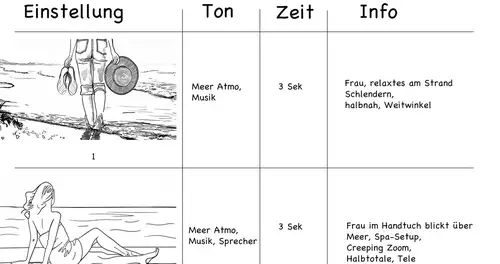Bildkontrolle und Gestaltung
Wird mit zwei Kameras aufgezeichnet -- und bislang gab es keine Alternative dazu, erst im Laufe des Jahres erscheinen erste Camcorder, die über eine Doppellinse verfügen --, müssen diese äußerst penibel eingerichtet und von den Einstellungen exakt synchronisiert werden. Wie oben erwähnt geht unser Sehzentrum, das die 3D-Bilder sozusagen entschlüsselt und interpretiert, davon aus, daß jede Abweichung (sog. Disparität) zwischen dem linken und rechten "Signal" ein Hinweis auf die Größe und Lage des Gesehenen liefert. Gewünscht ist daher unbedingt nur jene horizontale Disparität, die den 3D-Effekt ermöglicht. Jeder andere Unterschied zwischen den Bildern stört -- sei es, daß die Bilder um ein paar Pixel vertikal zu einander verschoben sind, oder daß verschiedene Bildeinstellungen gewählt wurden (Blende, Shutter, Fokus, Weißabgleich, Zoom etc..).
Auch zeitlich müssen die zwei Videoströme genau synchronisiert sein, da ein Versatz ebenso unangenehm für den Betrachter ist oder sogar den Effekt stören kann. Über Genlock/Lanc können mehrere Kameras simultan gestartet werden (eine altmodische Klappe einzusetzen empfiehlt sich dennoch als Backup).
Es müssen übrigens zwei baugleiche Camcordermodelle zum Einsatz kommen, damit die Bilder annähernd identisch werden können. Bringt man diese nebeneinander an, ist die minimale Stereobasis vom Bautyp begrenzt (d.h. das Gehäuse der Camcorder erlaubt es nicht, sie bzw. ihre optischen Achsen weiter anzunähern), daher wird bei anspruchsvollen Produktionen ein 3D-Spiegelrig verwendet. Darin werden die zwei Kameras um 90 Grad versetzt zu einander montiert, eine filmt horizontal, die andere vertikal von oben – ein halbdurchlässiger Spiegel lenkt den Bildstrahl auf letztere um.

Bei den einfacheren 3D-Camcordern, die nun rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft erscheinen, läßt sich praktisch nichts einstellen. Dies bedeutet weniger Gefrickel bei der Aufnahme, aber auch sehr viel weniger Flexibilität, da man sich im Rahmen bewegen muß, den die Kamera vorgibt.
Abgesehen von den korrekten und für die Aufnahmesituation passenden, stereographischen Einstellungen an den Kameras/der 3D-Kamera, gibt es noch jede Menge weitere Faktoren beim Dreh zu beachten, um zu guten 3D-Bildern zu gelangen.
Verabschieden sollte man sich beispielsweise von dem bildgestalterischen Stilmittel des (va. seitlichen) Anschneidens, wenn die Bildinhalte später beim Betrachten scheinbar vor der Leinwand liegen bzw. aus ihr herausragen sollen. Denn was sich vor dem Bild befindet, kann nicht von den Bildrändern verdeckt (also angeschnitten) werden, das läuft der Raumlogik zuwider und zerstört den dreidimensionalen Eindruck.

Möchte man jedoch immer komplett unter Kontrolle haben, was sich wann wo im Bild befindet, ist ein spontanes Drehen und natürlich auch Agieren (seitens der Schauspieler) nur eingeschränkt möglich.
Licht ist ein anderes Thema, das nicht zu kurz kommen sollte. Zunächst ist es gut, für genug Licht beim Dreh zu sorgen, da je nach Aufnahme- und Abspielsituation viel Licht geschluckt wird: Dreht man etwa mit Panasonics SDT750, sinkt die Lichtstärke durch den 3D-Objektivvorsatz, und bei dem Shutter-Verfahren, wo beim Abspielen das rechte und linke Bild abwechselnd gezeigt wird, gehen beispielsweise systembedingt mindestens 50% der Bildhelligkeit verloren.
Ferner verursachen große Kontraste im Bild sogenanntes Ghosting, also schwache Geisterbilder, was den Seheindruck empfindlich stört. Das Problem tritt vor allem auf, wenn die kontrastierenden Bildteile nicht genau am Konvergenzpunkt liegen. Und glitzert etwas, zB. Wasser oder Schmuck, kann es im Bild schnell flirren, da die Lichtreflexe in den rechten und linken Bildern unterschiedlich sind.
Um mögliche Fehler schon beim Entstehen korrigieren zu können (der ein oder andere mag es sich bereits gedacht haben), ist eine Bildkontrolle in 3D schon am Set ist praktisch unerläßlich. Für eine entsprechende Möglichkeit, eine Live-Preview auszugeben, sollte also gesorgt sein und auch für genug Zeit, diese sorgfältig zu nutzen.
Abschließend noch ein Tipp, der uns besonders am Herzen liegt: Hype hin oder her, 3D kann durchaus eine tolle Bereicherung der Filmerei sein, und um sich mit der Technik vertraut zu machen, sind eigene Experimente ein Muß. Daß bei solchen Tests die Technik und der Look im Vordergrund stehen, und nicht die Geschichte, ist klar. Doch ebenso klar sollte sein, daß die 3D-Effekte alleine keinen Film ergeben, und ein schlechter Film wird durch 3D auch nicht besser. Clever eingesetzt jedoch können die räumlich gestaffelten Bilder als Teil einer neuen Filmsprache die Dramaturgie unterstützen. Das ist unserer Meinung nach das eigentlich Spannende an 3D, und der Grund, weshalb sich eine Beschäftigung mit dem Thema lohnt.
Im nächsten Teil werden wir uns die Besonderheiten der 3D-Postproduktion etwas näher anschauen, davor jedoch gibt´s ein längeres Interview mit Josef Kluger, der mit seiner KUK Filmproduktion in München seit über zehn Jahren in 3D dreht, beispielsweise auch für die BBC. Wir haben mit ihm über Konvergenz-Philosophien gesprochen, über das Lenken der Zuschauerblicke im 3D-Bild, Augenschmerzen und vieles mehr...