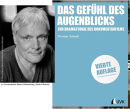Newsmeldung von slashCAM: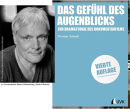
Thomas Schadts Buch über die Dramaturgie des Dokumentarfilms gilt als Standardwerk -- wir haben die Neuauflage zum Anlaß genommen, uns mit ihm über ein Genre in Auflösung zu unterhalten, über Glaubwürdigkeit und Kreativität, den Unterschied zwischen Dramaturgie und Storytelling und vieles mehr.
Hier geht es zum slashCAM Artikel:
Interviews: Thomas Schadt über den Dokumentarfilm im Wandel
Antwort von Axel:
Gestern wurde auf ARD eine interessante Doku gesendet,
Die nervöse Republik. Darin kam einmal mehr zum Vorschein, wie wenig Einfluss herkömmlicher seriöser Journalismus auf breite Schichten - und
diverse Schichten - der Bevölkerung hat, am deutlichsten sichtbar in der Spiegel-Redaktion am Tag der Brexit-Entscheidung. Der "Feed" ist nicht nur auf Facebook und Google durch Algorithmen gefiltert. Gleichgültig, ob es sich um immer unbedeutender werdende Printmedien oder Push-Nachrichten auf mobile Geräte handelt: der Einzelne bekommt tendenziell eine seinen Vorlieben zurechtgeschneiderte Information "zugeteilt". Was tun, wenn das Verifizieren von Behauptungen für den Einzelnen praktisch unmöglich, für die meisten aber (tatsächlich!)
verdächtig ist? Weil nämlich unterstellt wird, dass das Entlarven von Fake-News Propaganda ist, um von der eigenen Lüge abzulenken? Eine Redakteurin (ab ca. 23') fasst es gut zusammen. Teil der Lügenpresse zu sein, ist schrecklich, ermüdend, frustrierend. Und aussichtslos, würde ich hinzufügen. Ein Kampf, den man nicht gewinnen kann.
Antwort von Funless:
Ja die Doku hab' ich gestern auch gesehen und fand' sie sehr gut und interessant.
Bei dem was der Diekmann da bzgl. Neutralität von Journalisten von sich gegeben hat wusste ich ehrlich gesagt nicht ob ich es gut oder schlecht finden soll.
Ich war zugegebenermaßen ... irritiert.
Antwort von rob:
Hi Axel,
Danke für den Link.
Viele Grüße
Rob
Axel hat geschrieben:
Gestern wurde auf ARD eine interessante Doku gesendet, Die nervöse Republik. Darin kam einmal mehr zum Vorschein, wie wenig Einfluss herkömmlicher seriöser Journalismus auf breite Schichten - und diverse Schichten - der Bevölkerung hat, am deutlichsten sichtbar in der Spiegel-Redaktion am Tag der Brexit-Entscheidung. Der "Feed" ist nicht nur auf Facebook und Google durch Algorithmen gefiltert. Gleichgültig, ob es sich um immer unbedeutender werdende Printmedien oder Push-Nachrichten auf mobile Geräte handelt: der Einzelne bekommt tendenziell eine seinen Vorlieben zurechtgeschneiderte Information "zugeteilt". Was tun, wenn das Verifizieren von Behauptungen für den Einzelnen praktisch unmöglich, für die meisten aber (tatsächlich!) verdächtig ist? Weil nämlich unterstellt wird, dass das Entlarven von Fake-News Propaganda ist, um von der eigenen Lüge abzulenken? Eine Redakteurin (ab ca. 23') fasst es gut zusammen. Teil der Lügenpresse zu sein, ist schrecklich, ermüdend, frustrierend. Und aussichtslos, würde ich hinzufügen. Ein Kampf, den man nicht gewinnen kann.
 |
Antwort von handiro:
Aussichtslos weil diese sogenannten "Qualitätsmedien" völlig hirnlos und merkbefreit auf die ganzen überflüssigen "social media" aufgesprungen sind und denen hinterherhecheln wie ein Hund hinter einem Ball. Überall dieser Bratzenfluch mit seinem "f", das dumme Vögelchen und die in Bangladesh gekauften "likes". Youtube löscht Milliarden "likes" und "views" der Musikverlegermafia von Universal, Sony und BMG. Dazu die im Natoenddarm befindliche Rethorik des NDR bei der Ukraine-Krise. Mein Mitleid für die "Vierte Macht" hält sich in Grenzen. Da hilft auch dieser gute Film nichts, denn hier kommt alle 5 min. des Wort "mein Bratzenfluch account" vor und das eben zu Recht!
Ich vergass noch den "klickbait journalism" der in seiner übelsten Ausprägung in den USA entstand und soeben erhielt "jetzt.de" den Grimme Preis????
Antwort von Jalue:
Den Bedeutungsverlust haben sich etablierte Medien durchaus selber zuzuschreiben. Während meines Studiums wurde mir beigebracht, dass Informationsvermittlung und Kommentierung zu trennen sind. Das ist die klassische, aus dem angelsächsischen Kulturraum stammende Auffassung von Journalismus, die letztlich Respekt vor dem Leser/Zuschauer ausdrückt: denkende Menschen, die nicht belehrt werden müssen, da sie sich aufgrund der Faktenlage eine eigene Meinung zu bilden vermögen.
Bei jüngeren Kollegen stelle ich immer wieder fest, dass diese Grundhaltung offenbar unmodern geworden ist. So manche(r) neigt dazu, Tatsachen zu verbiegen oder wegzulassen, um einen gewissen Spin zu erzeugen. Die Ursachen wären zu erforschen, ich tippe auf eine Ideologisierung sozialwissenschaftlicher Fachbereiche und die zunehmende Vermischung von PR und Journalismus, auch in den Lehrplänen publizistischer Fakultäten.
Der Leser/Zuschauer spürt die manipulative Absicht allerdings, sucht angewidert nach Alternativen und landet dann bei Angeboten, die gar nichts mehr mit Journalismus zu tun haben, sondern nur noch pure (Gegen-)Propaganda sind. Die Folge ist ein vergifteter und zunehmend aggressiver öffentlicher Diskurs. Der Film von Stephan Lamby spiegelt dieses Dilemma.
Antwort von mash_gh4:
Jalue hat geschrieben:
Während meines Studiums wurde mir beigebracht, dass Informationsvermittlung und Kommentierung zu trennen sind. Das ist die klassische, aus dem angelsächsischen Kulturraum stammende Auffassung von Journalismus, die letztlich Respekt vor dem Leser/Zuschauer ausdrückt: denkende Menschen, die nicht belehrt werden müssen, da sie sich aufgrund der Faktenlage eine eigene Meinung zu bilden vermögen.
der noam chomsky hat diesen punkt unlängst in einem interview ein klein wenig anders kommentiert (siehe letzter abschnitt in der textfassung):
http://orf.at/stories/2387847/2387830/
Antwort von stepanek:
Hier eine eher kritische Einschätzung zur "Nervösen Republik":
Der ARD-Film "Nervöse Republik" ist Symptom des Problems
https://www.heise.de/tp/features/Wie-ne ... 91132.html
Antwort von handiro:
Eine sehr gute Kritik auf heise. Hier noch ein lesenswerter Artikel zum Thema Journalismus:
https://www.heise.de/tp/features/Bleibe ... 79301.html