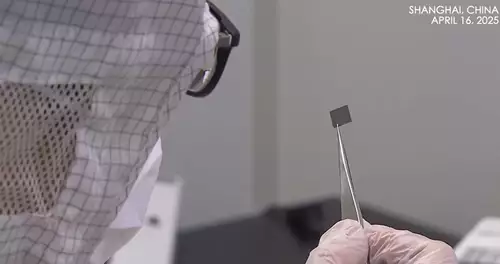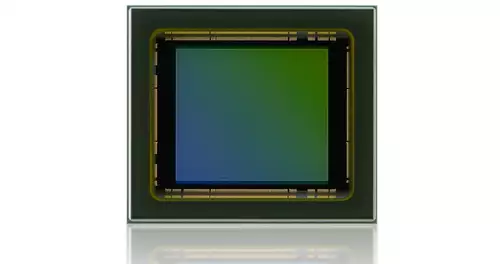Wieviel Technik passt in einen VW-Bus?
Soweit ich weiß, hattet ihr mehrere verschiedene Kameras im Einsatz – welche denn genau, und weshalb?
Da der Film über einen so langen Zeitraum gedreht wurde, haben wir die Kameras im Produktionsprozess mehrmals upgegradet, sehr zum Horror des Coloristen. (An der Stelle nochmals einen riesigen Dank für die super Arbeit und Unterstützung an Swen und Jonas von WeFadeToGrey.)
Konzeptuell muss man unseren Dreh in zwei Bereiche teilen: Den situativ-dokumentarischen Dreh und den ästhetischen “Sport”-Dreh.
Ganz am Anfang hatten wir noch eine Sony FS5 mit externem Recorder – der Großteil des Films ist aber auf der Blackmagic URSA Mini Pro G2 gedreht, ein Teil am Ende mit der Canon C70. Die URSA hat bei genug Licht nach wie vor ein unglaublich schönes Bild, und Blackmagic RAW bietet ein gutes Verhältnis von Qualität und Speichergröße. In den situativen Szenen ist eine große Schulterkamera, mit der man schnell reagieren kann und lange Takes mitnehmen kann, unersetzlich. Für das dokumentarische Drehen ist es wichtig, eine Schulterkamera mit Sucher und den richtigen Knöpfen zu haben, mit der man auf wechselnde Situationen reagieren kann und gleichzeitig auf Eye-Level der Protagonist:innen ist.

Der Ton lief immer extern, da wir teils 4 Funkstrecken in Betrieb hatten. Daher waren auch die Tentacle Sync für Timecode essentiell, gerade wenn mit zwei Kameras gedreht wurde. Das Tonequipment wäre nochmal eine Rubrik für sich; am Ende haben wir auf einem Wisycom System gedreht…
Für die Surfaufnahmen war Slow-Motion wichtig. Die allerersten Wasseraufnahmen sind 2017 noch mit einer Canon 5D Mark III und Magic Lantern RAW entstanden, davon ist aber kein Shot im Film gelandet. Bei 2-3 Meter Welle in einem dicken Neoprenanzug mit Flossen über ein glitschiges Riff zu laufen, um dann 20 Minuten gegen die Wellen rauszuschwimmen, ist anstrengend genug – Aufhänger von Magic Lantern sind dann das Letzte, was man braucht. Zum Glück läuft unser heutiges Equipment stabiler.
Als zweite Wasserkamera kam eine GH5S zum Einsatz, danach folgte die R5.
Zum Glück spielte das Overheating nach dem Softwareupdate irgendwann keine Rolle mehr. Das ist ein paar Mal im Wasser vorgefallen, bei langen Aufnahmen ohne große Pausen zwischendurch, und das möchtest du wirklich nicht haben, wenn du draußen im Wasser bist.

Die Wasserkameras doppelten auch immer als Gimbalkamera an Land.
Drohnen: Phantom 4 Pro und Mavic 3 Pro – alles Größere wäre in einem kleinen Team von 2-3 Leuten schwer handlebar gewesen.
Ehrlich gesagt waren wir mit 2-3 Kameras, Wassergehäuse, Drohne, Stative, Gimbal, Lichtsetup, Tonequipment, Flossen, Neoprenanzügen etc. sowieso schon ziemlich am Limit des Machbaren. Sowohl unser Übergepäck als auch der Stauraum im VW Bus ist aus allen Nähten geplatzt.
Kleine Randnotiz: Ihr hattet vor einiger Zeit einen Artikel über DGO Sensoren - uns ist dann aufgefallen, dass wir unbewusst mit den zwei Kameras drehen, die DGO Sensoren haben - C70 & URSA Mini Pro G2… ich denke in unkontrollierter Umgebung ist Dynamik einfach superwichtig für ein cinematisches Bild.
Was waren denn eure wichtigsten Brennweiten?
Dokumentarisch-situativ: Canon EF 24-70 2.8 ii – das Arbeitstier. Das Objektiv musste zwar nach der Produktion in den Service, weil Sand aus halb Europa im Getriebe war, ist aber immer noch in Betrieb.

Surf-Aufnahmen: mit Stativ von Land aus hatten wir das Sigma 150-600mm mit 1.4er Telekonverter an der URSA, was mit Crop dann effektiv 1200mm Brennweite ergibt.
Im Wassergehäuse: Canon 24-70 2.8 ii und 16-35 2.8 ii
Luftaufnahmen: Erst Phantom 3, dann Phantom 4, dann die Mavic 3 Pro - hier hat es sogar ein Shot von der qualitativ eigentlich viel zu schlechten Zoom-Kamera in den Film geschafft. Mit genug Licht und dem richtigen Grading funktioniert das erstaunlich gut.
Weitere Linsen waren Canon EF 70-300 4-5.6 L | Canon 50mm 1.4 | Canon 100mm 2.8 L | Sigma ART 18-35 1.8 | Sigma ART 24-70 2.8
Worauf habt ihr bei der Bildästhetik besonders geachtet?
Eine Kritik zu unserem Film hat geschrieben, der wäre “ein bisschen zu schön” für einen Dokumentarfilm, das würde “nicht zum inhaltlichen Anspruch passen” - was für ein schönes Kompliment!
Für uns sind schöne Bilder und inhaltliche Tiefe kein Widerspruch, es war von Anfang an das Konzept des Films, mit diesen Bildebenen zu spielen: Den fast werbigen Surf- und Landschaftsaufnahmen und den direkten, situativ gedrehten Szenen nah an den Protagonist:innen.

Surfen ist Freiheit, aber auch Eskapismus: man vergisst alles um sich herum und ist voller Endorphine. Das wollten wir auch darstellen, diese Momente erleben alle unsere Protagonist:innen. Gerade z.B. an der Küste Spaniens bildet dieser Ästhetikwechsel eine Realität ab: Wunderschöne Strände mit wohlhabenden Touristen, die in den gleichen Wellen surfen, in denen Migranten ertrinken.
Diese Parallelität wollten wir auch auf der Bildebene abbilden.

Ab 2022 hat Noah von Thun uns als DoP begleitet, mittlerweile ist er fester Bestandteil von VeyVey Films. Auch für Noah war es eine spannende Herausforderung, am Set zwischen den sehr unterschiedlichen Drehsituationen zu switchen. Während man in den situativen Momenten alles für den Schnitt "liefern" muss und bewusst die Szene auflöst, kann man bei den ästhetischen, konzeptuellen Szenen auf die Schnittbilder verzichten und voll in die ästhetische Welt eintauchen.
Wie habt ihr die Wasseraufnahmen realisiert? Ich stelle mir das unheimlich schwer vor - alles ist im Fluss, man hat wenig Kontrolle, gerät unter Umständen auch mal in den Weg…
Das Faszinierende an Wasseraufnahmen ist, dass es keine Abkürzung gibt. Man steckt die Kamera in ein Unterwassergehäuse, zieht sich kurze Flossen an, in Irland einen dicken Neoprenanzug und schwimmt gegen die Wellen hinaus auf das Meer.
Man sollte definitiv etwas Erfahrung im Surfen mitbringen, denn man muss viel antizipieren: die Welle, das Licht, die Strömung, die Bewegungen der Surfer:innen und deren Linienwahl auf der Welle.
Du musst die Welle verstehen und dich so positionieren, dass du sozusagen versetzt zum Surfer oder zur Surferin schwimmst. Die Tretbewegungen der Flossen müssen dabei vom Oberkörper “entkoppelt” werden, ähnlich wie beim “Steadycam-Walk” – halt nur im Wasser.

Dabei bekommt man alle großen Wellen auf den Kopf, wird genauso durchgewaschen wie die Surfer, und gleichzeitig zieht die Strömung oft dahin, wo man nicht sein will. Körperlich ist das sehr anstrengend und es gibt extrem viel Ausschuss – manchmal hat man nach 1-2 Stunden im Wasser vielleicht ein paar Sekunden gutes Material. Das Ganze hat ein analoges Feeling, weil man erst beim Sichten wirklich weiß, ob alles geklappt hat. Es muss viel zusammenkommen für eine gute Aufnahme. Dafür sitzt man dann abends manchmal jubelnd vorm Laptop und feiert einen guten Shot.