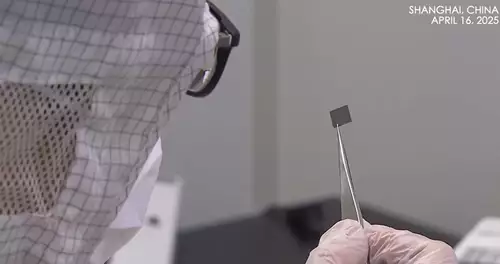Frage von Axel Farr:Folgendes:
ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken, mit einen Heimkino-PC
zuzulegen. Am Anfang dachte ich dabei daran, den Desktop bei mir zu hause
einfach zu diesem Zweck zu nutzen, aber das ist ein Pentium-4 mit 2,4 GHz,
der relativ laut ist. Zwar habe ich im Wohnzimmer einen Beamer, der ohnehin
schon eine gewisse Geräuschkulisse generiert, aber der PC ist mir da ehrlich
gesagt noch einen Tick zu laut (;wäre aber auch eine Möglichkeit, den leiser
zu bekommen, wenn es denn ein P-4 sein müßte).
Wo ich jetzt am grübeln bin: Mein Beamer kann HDTV in einer Auflösung von
1280x720. Daher wäre es nett, wenn der PC zumindest in der Lage wäre, Videos
in dieser Auflösung wiederzugeben, im Moment sind da einige HDTV-Scheiben
verfügbar, die in WMV-HD kodiert sind und für die mein Notebook (;ein 1,4 GHz
Pentium-M) etwas zu schwach auf der Brust ist (;geringfügiges Ruckeln bei der
Wiedergabe), die aber vom Desktop prima bewältig werden.
An stromsparenden Alternativen gäbe es jetzt Mini-ITX-Boards, die entweder
mit Vias C3-Prozessor auskommen würden (;energiesparender als ein Pentium-M,
aber vermutlich auch langsamer) oder den Via Eden (;ca. Faktor 3 geringere
Rechenleistung als ein Pentium-M oder C3) benutzen könnten. Der C3 benötigt
einen aktiven Kühler, der Eden kommt mit dem Luftstrom vom Netzteillüfter
aus. Diese Boards und die entsprechenden Prozessoren sind sehr preisgünstig,
und die Chipsätze von Via enthalten bereits einen MPEG-Decoderbaustein, der
für die Dekodierung von WMV zumindest einen Teil der Arbeit übernehmen
könnten (;auch Microsofts Codec basiert auf der diskreten
Kosinustransformation, die der Chipsatz in Hardware kann). Theoretisch müßte
also zumindest die Variante mit dem C3-Prozessor in der Lage sein, WMV-HD in
720p mit 24Bildern/s zu dekodieren. Bei dem Eden wäre die Nutzbarkeit auf
PAL-Video beschränkt, und da wäre es auch nur sinnvoll mit MPEG-Streams,
sprich: DVD-Wiedergabe oder Wiedergabe von DVB-Streams.
Die Frage hier: Gibt es von Via Treiberunterstützung für den Windows Media
Player, so daß der mit Hardwareunstützung WMV-HD dekodieren kann? Wenn das
nicht geht, dann wäre für mich die interessantere Alternative ein
Eden-System mit Beschränkung auf PAL.
Die andere stromsparende Alternative wäre eben ein Rechner mit Pentium-M (;ab
ca. 1,8 GHz müßte der ruckelfrei WMV-HD rein in Software dekodieren können),
da kenne ich bis jetzt allerdings auch nur Mainboards in Mini-ITX-Baugröße,
keine als Mini-ATX oder "große" ATX. Hinzu kommt, daß sowohl die Boards als
auch die Prozessoren sehr viel teurer sind als bei Via, so daß das preislich
eher über einer Lösung mit einem P-4 oder einem Athlon-64 liegen würde (;die
aber beide regelrechte Stromfresser sind und ich da eher hergehen würde und
würde meinen Desktop etwas in der Geräuschentwicklung bremsen).
Da man bei Mini-ITX sehr eingeschränkt ist von den Anschlußmöglichkeiten (;es
steht lediglich ein PCI-Steckplatz zur Verfügung, der noch dazu für eine
DVB-Karte draufgehen würde) wäre ich auch an einer Lösung mit ATX- oder
Mini-ATX-Board interessiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Axel Farr
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Matthias Eller:
Axel Farr schrieb:
> Theoretisch müßte
> also zumindest die Variante mit dem C3-Prozessor in der Lage sein, WMV-HD in
> 720p mit 24Bildern/s zu dekodieren. Bei dem Eden wäre die Nutzbarkeit auf
> PAL-Video beschränkt, und da wäre es auch nur sinnvoll mit MPEG-Streams,
> sprich: DVD-Wiedergabe oder Wiedergabe von DVB-Streams.
vergiss es.
Mein C3 800 schafft Xvid mit 640x480 grad so. Mit nem selbstgebackenem
MPlayer. Alles darüber ist illusorisch.
MfG
Matthias Eller
Antwort von Axel Farr:
Hallo Matthias,
"Matthias Eller"
schrieb im Newsbeitrag
> Axel Farr schrieb:
>
>> Theoretisch müßte
>> also zumindest die Variante mit dem C3-Prozessor in der Lage sein, WMV-HD
>> in
>> 720p mit 24Bildern/s zu dekodieren. Bei dem Eden wäre die Nutzbarkeit auf
>> PAL-Video beschränkt, und da wäre es auch nur sinnvoll mit MPEG-Streams,
>> sprich: DVD-Wiedergabe oder Wiedergabe von DVB-Streams.
>
> vergiss es.
>
> Mein C3 800 schafft Xvid mit 640x480 grad so. Mit nem selbstgebackenem
> MPlayer. Alles darüber ist illusorisch.
Mit oder ohne Unterstützung des MPEG2-Decoders im Chipsatz? Daß der Elan
nicht reicht, um ohne Hardware-Decoder überhaupt DVDs zu decoden weiß ich,
nur ist mir eben unklar, was und wieviel der MPEG2-Decoder überhaupt schafft
und was er bei H.264-Codecs überhaupt bringt (;btw: Zu welchem Typus gehört
XviD/DivX denn? Ich hatte bis jetzt angenommen, daß der vom Algorithmus in
der Kategorie spielt, in dem auch WMV liegt, sowohl was Rechenzeit als auch
was die benötigten Algorithmen angeht).
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Matthias Eller:
Axel Farr schrieb:
> Mit oder ohne Unterstützung des MPEG2-Decoders im Chipsatz?
Meine Aussage bezieht sich auf meinen VDR PC. Unter Linux gibts leider
nicht so wirklich eine Unterstützung für den HW Decoder. Außerdem hat
mein Board noch den älteren Chipsatz. Aber all zu groß wird der Sprung
zum CLE266 Chipsatz auch nicht ausfallen.
> Daß der Elan
> nicht reicht, um ohne Hardware-Decoder überhaupt DVDs zu decoden weiß ich,
> nur ist mir eben unklar, was und wieviel der MPEG2-Decoder überhaupt schafft
> und was er bei H.264-Codecs überhaupt bringt
Ich glaub viel bringt er nich.
> (;btw: Zu welchem Typus gehört XviD/DivX denn?
MPEG4 advanced simple profile
btw: MPEG2 decodiert meine DVB-Karte...
MfG
Matthias Eller
Antwort von Axel Farr:
Hallo Matthias,
danke für Deine Infos. Vermutlich werde ich für's erste mal meinen normalen
Desktop-PC mit einer DVB-S-Karte ausrüsten und mal schauen, ob sich das für
mich mit meinen Anforderungen lohnt. Schauen wir mal. Wenn ich vom Konzept
eines solchen PC (;egal ob unter Linux oder mit der Windows-Software der
Karte) überzeugt bin, dann werde ich mir vermutlich einen solchen Rechner
aufbauen.
"Matthias Eller" schrieb im Newsbeitrag
> Axel Farr schrieb:
>
>> Mit oder ohne Unterstützung des MPEG2-Decoders im Chipsatz?
>
> Meine Aussage bezieht sich auf meinen VDR PC. Unter Linux gibts leider
> nicht so wirklich eine Unterstützung für den HW Decoder. Außerdem hat
> mein Board noch den älteren Chipsatz. Aber all zu groß wird der Sprung
> zum CLE266 Chipsatz auch nicht ausfallen.
Angeblich gibt es von Via Treiber für den Decoder...
>> Daß der Elan
>> nicht reicht, um ohne Hardware-Decoder überhaupt DVDs zu decoden weiß
>> ich,
>> nur ist mir eben unklar, was und wieviel der MPEG2-Decoder überhaupt
>> schafft
>> und was er bei H.264-Codecs überhaupt bringt
>
> Ich glaub viel bringt er nich.
Danke für diese Einschätzung.
>> (;btw: Zu welchem Typus gehört XviD/DivX denn?
>
> MPEG4 advanced simple profile
Also zur Familie der H.264-Codecs.
> btw: MPEG2 decodiert meine DVB-Karte...
Ja, das soll für Linux-PCs die keine schnelle CPU haben (;ohnehin die bessere Lösung sein. Bei einem P-4 macht es dann wahrscheinlich
nichts mehr aus, aber dann hat man eben wieder eine ziemlich
leistungshungrige CPU im System. Problematisch ist ja nicht der
Leistungsverbrauch an sich, sondern alleine schon die Tatsache, daß viele
der P-4-CPUs im Leerlauf schon 40 bis 70W verbraten.
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Willmut:
Axel Farr wrote:
snip
Strom sparen und Heimkino mit Beamer und Dolby Digital, aktiven
Subwoofer usw.!? Passt irgendwie nicht zusammen ;) (;leider)
Antwort von Willmut:
Hergen Lehmann wrote:
> Willmut wrote:
>
>>Strom sparen und Heimkino mit Beamer und Dolby Digital, aktiven
>>Subwoofer usw.!? Passt irgendwie nicht zusammen ;) (;leider)
>
> Wieso? Die Verstärker fressen im Mittel vielleicht 30-50W (;das ist
> dann schon ziemlich laut), der Beamer um die 200W.
> Da fällt ein moderner PC mit je nach Ausstattung 150W und mehr schon
> ziemlich deutlich ins Gewicht, so daß durchaus verständlich ist, daß
> der OP erstmal an dieser Stelle optimieren will.
Hergen Lehmann wrote:
>> Willmut wrote:
>>
>
>>>>Strom sparen und Heimkino mit Beamer und Dolby Digital, aktiven
>>>>Subwoofer usw.!? Passt irgendwie nicht zusammen ;) (;leider)
>
>>
>> Wieso? Die Verstärker fressen im Mittel vielleicht 30-50W (;das ist
>> dann schon ziemlich laut), der Beamer um die 200W.
Naja, was man so Heimkino nennt... Ich dachte da vielleicht an bessere
Anlagen und nicht an diese Neckermann-Dinger bei denen mehr Know How in
den Katalogversprechungen zu finden ist, als im Gerät selbst ;)
Hier mal ein paar "seriösere" Anhaltspunkte zum rechnen:
AV-Receiver ca. 250 Watt, Beamer (;Heimkinotauglich) ca. 200 Watt
Boxenset mit aktivem Sub ca 200 Watt, PC (;schneller) 200 Watt
Dann nicht vergessen: SAT-Receiver, DVD-Player usw. da kommen nochmal
bestimmt nochmal zusammengerechnet 100 Watt dazu, wären wir zusammen
also schon mal bei 900 Watt.
Ob da der PC 10 Watt mehr oder weniger braucht, ist IMO unerheblich.
Natürlich sollte man Energie sparen, wo immer es geht, doch auch an den
Kosten-Nutzen-Faktor denken.
W.
Antwort von Ralf Fontana:
Willmut, dessen Eltern so arm waren das sie sich keinen Nachnamen leisten
konnten, schrieb:
[TOFU gequottel gelöscht, lern quoten]
> Hier mal ein paar "seriösere" Anhaltspunkte zum rechnen:
Enfach nur die Wattangaben der Netzteile zu addieren ist nicht seriös.
Antwort von Lutz Bojasch:
Hergen Lehmann wrote:
> Willmut wrote:
>
>> Hier mal ein paar "seriösere" Anhaltspunkte zum rechnen:
>>AV-Receiver ca. 250 Watt, Beamer (;Heimkinotauglich) ca. 200 Watt
>>Boxenset mit aktivem Sub ca 200 Watt, PC (;schneller) 200 Watt
>
> Wenn Du tatsächlich 450W Audioleistung in ein Wohnzimmer blasen
> willst, solltest Du vorab schon mal Termine mit dem Glaser, dem
> Ohrenarzt und dem Rechtsanwalt machen.
Hallo
Langsam sollte sich mal rumsprechen, daß Leistung nicht
gleichbedeutend mit Lautstärke ist.
> Verwechsle bitte nicht die theoretische Spitzenleistung mit der
> durchschnittlichen Leistungsaufnahme im normalen Betrieb.
Die genannten Werte sind durchaus Normalwerte und keine Spitzenleistungen.
Die ist mit
> 50W schon recht hoch angesetzt, normalerweise reichen im Wohnzimmer
> 5-10W Ausgangsleistung für gehobene Zimmerlautstärke (;Röhrenverstärker
> u.ä. Energieverschwender mal ausgemommen).
Dann doch gleich einen Neckermann-Verstärker der bei 20 Watt
Leistungsaufnahme 2000Watt erzeugt ;)
>>Dann nicht vergessen: SAT-Receiver, DVD-Player usw. da kommen nochmal
>>bestimmt nochmal zusammengerechnet 100 Watt dazu, wären wir zusammen
>>also schon mal bei 900 Watt.
>
> Ich sehe keinen sinnvollen Anwendungsfall, bei dem SAT-Receiver,
> DVD-Player und HTPC gleichzeitig laufen müssen, zumal wenn der HTPC
> mit DVD-Laufwerk und DVB-Karte ausgerüstet ist.
> Und ich kenne auch keine DVD-Player oder SAT-Receiver, die 100W ziehen
> würden. ^ -
Sicher waren die 100W für "den Rest" gedacht. Wer z.B. noch
Videorecorder zu laufen hat, müsste auch die dazurechnen.
> Eben. Und da ist der PC (;und speziell der HTPC) einer der grössten
> Energieverschwender im Haushalt.
>
> Aus dem Beamer/TV kommen wenigstens noch Licht, und aus der
> Audioanlage etwas Schall heraus. Aber der gut ausgestattete HTPC
> verheizt 30-40% der Gesamtenergieaufnahme der Heimkino-Anlage komplett
> in Wärme.
Ach komm, das ist doch jetzt wieder die übliche NG-Spielerei, es geht
nicht um die Sache, sondern ums Gelaber. Wenn der PC so ein Stromfresser
ist, warum dann die Zeit in den NG verplempern!? Nebenbei würde ein Film
vom Stand-Alone DVD Player dann energetisch billiger sein.
Antwort von Lutz Bojasch:
Hergen Lehmann wrote:
>>
>>Die genannten Werte sind durchaus Normalwerte und keine Spitzenleistungen.
>
> 450W Sinus Dauerleistung im Wohnzimmer sind ein Normalwert. Ja,
> sicher.
> Komm mal bitte wieder auf den Boden der Realität zurück!
Hallo
Kampfposter verlieren leicht die Übersicht: Es geht hier vor allem um
die Leistungsaufnahme eines "Heimkinos". Wenn Du mitreden kannst und
sowas eingerichtet hast, schlage mal in den technischen Daten nach und
addiere die Werte die Du da findest. Da kommt ganz schön was zusammen,
Grund genug für die Hersteller und den Handel, darüber möglichst nicht
zu reden.
> Irgendwie kann ich Deiner Argumentation gerade nicht folgen.
Lese mal die Betreff-Zeile und dann zurück zum Thema.
>>Sicher waren die 100W für "den Rest" gedacht. Wer z.B. noch
>>Videorecorder zu laufen hat, müsste auch die dazurechnen.
>
> Ich hab' auch noch nen Durchlauferhitzer und ne Mikrowelle. Muss ich
> die auch dazurechnen? ;)
Sorry, das ist mir zu blöd.
Lutz
EOT
Antwort von Andre Beck:
"Axel Farr" writes:
> "Matthias Eller" schrieb im Newsbeitrag
>
>> Axel Farr schrieb:
>>
>>> (;btw: Zu welchem Typus gehört XviD/DivX denn?
>>
>> MPEG4 advanced simple profile
>
> Also zur Familie der H.264-Codecs.
Nein. MPEG4 ASP ist ein schlichtes MPEG4 Video Profil. So ziemlich das
erste, das überhaupt was taugt. Die Unterschiede von da nach H.264 aka
MPEG4 Part 10 sind gewaltig (;Faktor 4 oder mehr).
--
The S anta C laus O peration
or "how to turn a complete illusion into a neverending money source"
-> Andre "ABPSoft" Beck ABP-RIPE Dresden, Germany, Spacetime <-
Antwort von Josef Erbs:
Hergen Lehmann schrieb:
> Bei manchen Geräten (;Beamer, TV, Standalone-Player) liegt dieser
> tatsächlich in einer ähnlichen Grössenordnung, bei anderen (;HTPC)
> liegt er je nach Dimensionierung des Netzteils etwas unterhalb, bei
> wieder anderen (;Verstärker) liegt er wegen grosser ungenutzter
> Leistungsreserven weit darunter.
Hi
da muß ich Dir zustimmen.
Bei guten Boxen wird der Wirkungsgrad mit angegeben.
Da kommt man durchaus auf 92-98 db(;A) bei einem Watt in einem Meter
Abstand. Pro Box.
5-10W Dauerleistung sind also für ein gängiges Wohnzimmer mehr als
ausreichend.
Außer, man hat eine Brüllwürfelsammlung mit megaschlechtem Wirkungsgrad
gekauft und braucht dann nen Hammerverstärker, damit der nicht in´s
Clipping kommt....
bye
Jupp
Antwort von Hans-Peter Diettrich:
Hergen Lehmann wrote:
> Es sollte sich auch langsam mal herumsprechen, daß bei normalen
> Lautsprechern (;%Schwingspule mit Membran dran, eingebaut in irgendeine
> Form von Holzgehäuse) für Zimmerlautstärke nur wenige Watt Leistung
> umgesetzt werden.
> Eine grosszügige Reserve ist wünschenswert, um Verzerrungen bei
> Lautstärkespitzen zu vermeiden und eine angemessene Bedämpfung der
> Lautsprecher sicherzustellen, aber wirklich nutzen wird man die nur
> extrem selten und immer nur für wenige Millisekunden.
Ich bin mir nicht sicher über den heutigen Stand der Technik, aber je
"hochwertiger" eine Box ist, desto geringer ist doch ihr Wirkungsgrad?
Lautsprecher sind nun mal sehr "un-ideale" Schallquellen, bei denen das
Ausbügeln von Nichtlinearitäten und Resonanzen den Hauptanteil der
Leistungsaufnahme ausmacht.
> Ich sage: reale 10W (;Sinus) an den Lautsprechern sind im Wohnzimmer
> bereits ziemlich laut, der Verstärker wird dabei kaum mehr als 50W aus
> dem Netz aufnehmen.
BTW, "Zimmerlautstärke" war mal 50 mW (;milli, nicht Mega ;-)
Insgesamt ist euer Streit recht theoretisch, warum nur schaffen sich die
Energispar-Freaks nur so selten Wattmeter an, oder lesen einfach mal den
Zähler ab? Damit könnte man solche Diskussionen ganz einfach auf eine
realistische Grundlage stellen.
Für Neuanschaffungen nützt eine Diskussion allerdings recht wenig, da
müßte man schon zum Händler gehen und dort die Messungen am lebenden
Objekt vornehmen.
DoDi
Antwort von Axel Farr:
Hallo Willmut,
"Willmut" schrieb im Newsbeitrag
Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
> Axel Farr wrote:
>
> snip
>
> Strom sparen und Heimkino mit Beamer und Dolby Digital, aktiven Subwoofer
> usw.!? Passt irgendwie nicht zusammen ;) (;leider)
Mir geht es beim PC um die Stromaufnahme vor allem im Betrieb mit relativ
wenig Last, da das der Normalfall bei der Aufnahme von Fernsehsendungen per
DVB darstellt (;die werden ja quasi nur von der Karte gestreamt und auf die
Festplatte aufgezeichnet). Dabei läuft auch nicht unbedingt gleichzeitig der
Beamer oder die Surroundanlage.
Zum Beamer: Mein PT-AE500 hat irgendwas um die 120W (;Heimkino-Beamer haben
in der Regel etwas weniger Leistung als Präsentationsbeamer, weil das
Kontrastverhältnis bei der Projektion in abgedunkelten Räumen wichtiger ist
als die absolute Helligkeit). Die 5.1-Anlage und der Subwoofer werden bei
"normalem" Betrieb noch mal so mit zusammen ~100 bis 150W zu Buche schlagen,
wenn überhaupt (;bitte von der Vorstellung abstand nehmen, daß man die
Maximalleistung von 5x80W 1x150W permanent als Ausgangsleistung hätte).
Ein letzter Punkt bei der Leistungsaufnahme: elektrische Leistung macht
einen PC auch "laut". Man braucht Lüfter, um die Wärme abzuführen, und die
sind oft nicht gerade für Heimkinobedürfnisse auf "leise" getrimmt.
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Hans-Peter Diettrich:
Hergen Lehmann wrote:
>
> Hans-Peter Diettrich wrote:
>
> >Ich bin mir nicht sicher über den heutigen Stand der Technik, aber je
> >"hochwertiger" eine Box ist, desto geringer ist doch ihr Wirkungsgrad?
>
> Jein.
> Eine hochwertige Hifi-Box wird sicher einen schlechteren Wirkungsgrad
> erreichen als eine auf maximalen Schalldruck optimierte PA-Box. Ihr
> Wirkungsgrad wird aber immer noch um Dimensionen besser sein, als der
> von irgendwelchen Billig-Brüllwürfeln.
Da bin ich durchaus skeptisch, außer wenn die Billig-Brüllwürfel
Lautsprecher mit erheblich schlechterem Wirkungsgrad haben
(;Dimensionen!).
> Zudem kann der Wirkungsgrad gerade bei leistungsfähigen Boxen nicht
> beliebig schlecht werden. Ein schlechter Wirkungsgrad bedeutet
> Wärmeentwicklung, und Wärme bekommt man von der Schwingspule nur sehr
> schlecht weg.
Das Wärmeproblem muß bei den Lautsprechern konstruktiv gelöst werden,
die müssen ja ihre angegebene Leistung auch verkraften können. Bei
größeren Leistungen sind die Wicklungen so dick, daß sie ihre Wärme
durchaus effizient an andere Teile des Lautsprechers abgeben können.
Eigentlich wollte ich schon vorher "Handauflegen" zur Kontrolle der
Leistungsaufnahme der einzelnen Komponenten vorschlagen, habe dann aber
doch darauf verzichtet ;-)
Zudem bin ich gerade bei Lautsprechern nicht sicher, wieviel Leistung
tatsächlich in der Schwingspule vernichtet wird, und wieviel an den
Magneten oder als Schall abgegeben wird, der dann anschließend im
Dämm-Material vernichtet wird. Eine Spule ist ja ein komplexer
Widerstand, dessen reeller (;ohmscher) Anteil AFAIR deutlich niedriger
sein kann als seine Impedanz. Dann wird in der Schwingspule ja nur die
reelle R*I^2 vernichtet, nicht aber die Scheinleistung. Leider habe ich
kein geeignetes Testobjekt zur Verfügung, um das hier selbst
nachzumessen...
> >Lautsprecher sind nun mal sehr "un-ideale" Schallquellen, bei denen das
> >Ausbügeln von Nichtlinearitäten und Resonanzen den Hauptanteil der
> >Leistungsaufnahme ausmacht.
>
> Nicht unbedingt. Es gibt sehr verschiedenartige Konzepte, die Probleme
> anzugehen, die teils sogar zu einer Steigerung des Wirkungsgrads
> führen.
> Ein Musterbeispiel wäre z.B. der Hornlautsprecher, der durchaus auch
> im High-End-Bereich seinen Platz gefunden hat, und der mit sehr gutem
> Wirkungsgrad aufwartet.
Das ist richtig, und gerade bei höheren Leistungen auch notwendig, um
eben die Erwärmung der ganzen Box zu reduzieren. Gerade bei den tiefen
Frequenzen wird ja allerhand konstruktiver Aufwand getrieben, um den
Schall optimal herauszubekommen, und dieser Aufwand sollte dann
sinnvollerweise schon beim Lautsprecher beginnen, nicht erst im Rest der
Box.
Aber vielleicht kommt ja irgendwann jemand auf die Idee, Lautsprecher
auch noch aktiv zu kühlen - als Verkaufsargument hört sich das doch gut
an? ;-)
DoDi
Antwort von Axel Farr:
Hallo Hans-Peter,
"Hans-Peter Diettrich" schrieb im Newsbeitrag
Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
> Hergen Lehmann wrote:
>>
>> Hans-Peter Diettrich wrote:
>>
>> >Ich bin mir nicht sicher über den heutigen Stand der Technik, aber je
>> >"hochwertiger" eine Box ist, desto geringer ist doch ihr Wirkungsgrad?
>>
>> Jein.
>> Eine hochwertige Hifi-Box wird sicher einen schlechteren Wirkungsgrad
>> erreichen als eine auf maximalen Schalldruck optimierte PA-Box. Ihr
>> Wirkungsgrad wird aber immer noch um Dimensionen besser sein, als der
>> von irgendwelchen Billig-Brüllwürfeln.
>
> Da bin ich durchaus skeptisch, außer wenn die Billig-Brüllwürfel
> Lautsprecher mit erheblich schlechterem Wirkungsgrad haben
> (;Dimensionen!).
Also mal folgendes: "Hochwertig" werden gute Boxen nicht ob ihres guten
(;elektrischen) Wirkungsgrades genannt, sondern weil sie eben in einem
möglichst breiten Frequenzbereich elektrische Energie möglichst "bildgleich"
in Schallwellen abbilden. Das hat nur relativ entfernt etwas damit zu tun,
wieviel der elektrischen Energie in Wärme verwandelt wird. Aber die Tendenz
ist schon richtig: Wenn man ein schlechtes Übereinstimmen zwischen
elektrischer Ansteuerung und resultierendem Schall hat, dann wird sicherlich
in einem gewissen Frequenzbereich Wärme statt Schall erzeugt, so daß man
annehmen kann, daß akustisch gute Boxen es auch elektrisch sind.
>> Zudem kann der Wirkungsgrad gerade bei leistungsfähigen Boxen nicht
>> beliebig schlecht werden. Ein schlechter Wirkungsgrad bedeutet
>> Wärmeentwicklung, und Wärme bekommt man von der Schwingspule nur sehr
>> schlecht weg.
>
> Das Wärmeproblem muß bei den Lautsprechern konstruktiv gelöst werden,
> die müssen ja ihre angegebene Leistung auch verkraften können. Bei
> größeren Leistungen sind die Wicklungen so dick, daß sie ihre Wärme
> durchaus effizient an andere Teile des Lautsprechers abgeben können.
> Eigentlich wollte ich schon vorher "Handauflegen" zur Kontrolle der
> Leistungsaufnahme der einzelnen Komponenten vorschlagen, habe dann aber
> doch darauf verzichtet ;-)
Haaalt: Lautsprecher sind so etwas wie "Motoren": Sie erzeugen aus
elektrischer Energie mechanische, nämlich Schallwellen. Sprich: eine
100W-Box muß nicht 100W elektrische Leistung in Wärme verwandeln, sondern
arbeitet eben so, daß bis zu einer Leistungsaufnahme von 100W elektrischer
Leistung ohne Verzerrungen (;mit weniger als 1% Klirrfaktor laut DIN)
mechanische Energie aus der elektrischen Leistung gemacht wird. Dabei
entsteht aufgrund des ohmschen Widerstands der Boxen etwas Verlustwärme, wie
groß die ist, kann man extrapolieren, wenn man den ohmschen Widerstand (;vor
allem der Tieftöner, denn die bekommen den Großteil der Leistung ab) gegen
die angegebene Impedanz setzt. Die Impedanz ist nämlich das, was die
Wechselspannung aufgrund des "arbeitenden" Lautsprechers sieht, während der
ohmsche Widerstand nur das ist, was bei einer unbewegten Membran ein
Gleichstrom sieht.
> Zudem bin ich gerade bei Lautsprechern nicht sicher, wieviel Leistung
> tatsächlich in der Schwingspule vernichtet wird, und wieviel an den
> Magneten oder als Schall abgegeben wird, der dann anschließend im
> Dämm-Material vernichtet wird. Eine Spule ist ja ein komplexer
> Widerstand, dessen reeller (;ohmscher) Anteil AFAIR deutlich niedriger
> sein kann als seine Impedanz. Dann wird in der Schwingspule ja nur die
> reelle R*I^2 vernichtet, nicht aber die Scheinleistung. Leider habe ich
> kein geeignetes Testobjekt zur Verfügung, um das hier selbst
> nachzumessen...
Es wird mitnichten aller realer Anteil des Widerstands für die Erwärmung
verwendet, sondern nur der ohmsche Anteil. Bei f!=0 machen aber auch die
"arbeitenden" Teile wie z.B. der bewegte Magnet einen realen Anteil der
Impedanz aus, der Induktive geht dann dafür zurück (;der Induktive Anteil ist
ja nur der Anteil, der wegen der Frequenz != 0 einen Teil der elektrischen
Energie im Magnetfeld speichert, diese Energie geht ja bei Feldumkehr wieder
raus und ist nicht verloren).
>> >Lautsprecher sind nun mal sehr "un-ideale" Schallquellen, bei denen das
>> >Ausbügeln von Nichtlinearitäten und Resonanzen den Hauptanteil der
>> >Leistungsaufnahme ausmacht.
>>
>> Nicht unbedingt. Es gibt sehr verschiedenartige Konzepte, die Probleme
>> anzugehen, die teils sogar zu einer Steigerung des Wirkungsgrads
>> führen.
>> Ein Musterbeispiel wäre z.B. der Hornlautsprecher, der durchaus auch
>> im High-End-Bereich seinen Platz gefunden hat, und der mit sehr gutem
>> Wirkungsgrad aufwartet.
>
> Das ist richtig, und gerade bei höheren Leistungen auch notwendig, um
> eben die Erwärmung der ganzen Box zu reduzieren. Gerade bei den tiefen
> Frequenzen wird ja allerhand konstruktiver Aufwand getrieben, um den
> Schall optimal herauszubekommen, und dieser Aufwand sollte dann
> sinnvollerweise schon beim Lautsprecher beginnen, nicht erst im Rest der
> Box.
Lautsprecher haben z.T. schon recht gute Wirkungsgrade. Nichtlinearitäten
entstehen im Grunde erst, wenn man den Strom zu weit hochfährt: Verluste bei
Feldumkehr, mechanische Verluste (;Wärme) beim Fell, elektrische Verluste in
der Spule.
[schnippel]
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Hans-Peter Diettrich:
Axel Farr wrote:
> Also mal folgendes: "Hochwertig" werden gute Boxen nicht ob ihres guten
> (;elektrischen) Wirkungsgrades genannt, sondern weil sie eben in einem
> möglichst breiten Frequenzbereich elektrische Energie möglichst "bildgleich"
> in Schallwellen abbilden. Das hat nur relativ entfernt etwas damit zu tun,
> wieviel der elektrischen Energie in Wärme verwandelt wird. Aber die Tendenz
> ist schon richtig: Wenn man ein schlechtes Übereinstimmen zwischen
> elektrischer Ansteuerung und resultierendem Schall hat, dann wird sicherlich
> in einem gewissen Frequenzbereich Wärme statt Schall erzeugt, so daß man
> annehmen kann, daß akustisch gute Boxen es auch elektrisch sind.
Sorry, Deine Schlußfolgerungen sind recht seltsam :-(;
Ein Lautsprecher (;ohne Box) liefert speziell bei tiefen Frequenzen keine
besonders gute Übereinstimmung zwischen zugeführter (;elektrischer) und
abgegebener (;akustischer) Schwingung. Eine Verbesserung kann nur durch
weitere Maßnahmen erreicht werden, außerhalb des Lautsprechers. Diese
Maßnahmen führen i.d.R. (;Dämpfung..., Ausnahme: Hörner) zu einem
schlechteren Wirkungsgrad. Wenn eine Box zur Reduzierung von
Verzerrungen bedämpft werden muß, dann reduziert diese Bedämpfung nicht
nur die "falschen" Schwingungen, sondern die gesamte Lautstärke und
damit den Wirkungsgrad. Im Extremfall (;Wirkungsgrad Null) sind die
Verzerrungen minimal, nämlich auch Null ;-)
> Haaalt: Lautsprecher sind so etwas wie "Motoren": Sie erzeugen aus
> elektrischer Energie mechanische, nämlich Schallwellen. Sprich: eine
> 100W-Box muß nicht 100W elektrische Leistung in Wärme verwandeln, sondern
> arbeitet eben so, daß bis zu einer Leistungsaufnahme von 100W elektrischer
> Leistung ohne Verzerrungen (;mit weniger als 1% Klirrfaktor laut DIN)
> mechanische Energie aus der elektrischen Leistung gemacht wird. Dabei
> entsteht aufgrund des ohmschen Widerstands der Boxen etwas Verlustwärme, wie
> groß die ist, kann man extrapolieren, wenn man den ohmschen Widerstand (;vor
> allem der Tieftöner, denn die bekommen den Großteil der Leistung ab) gegen
> die angegebene Impedanz setzt. Die Impedanz ist nämlich das, was die
> Wechselspannung aufgrund des "arbeitenden" Lautsprechers sieht, während der
> ohmsche Widerstand nur das ist, was bei einer unbewegten Membran ein
> Gleichstrom sieht.
Die korrekte Rechnung hatte ich bereits angegeben, die in der Spule
vernichtete Energie ist R*I^2. R ist gegeben, und I ist der tatsächlich
durchfließende Strom, egal wie dieser Stromfluß zustandekommt. Im
schlechtesten Fall fließt nur Blindstrom, der keinerlei Wirkleistung
erzeugt, sondern nur Wärme. Die Impedanz hat nur insofern einen Einfluß,
als sie die Abhängigkeit zwischen zugeführter Spannung und zugeführtem
Strom beschreibt, wobei AFAIR vorausgesetzt bzw. angenommen wird, daß
beide in Phase sind. In der Praxis sind oft irgendwelche Phasenschieber
oder Filter notwendig, um einen Lautsprecher in einem gewissen
Frequenzbereich in einen einigermaßen reellen Widerstand (;mit der
entsprechenden Impedanz) zu verwandeln. Dies geht aber auch nicht ohne
weitere Verluste. Und letztendlich gibt es noch weitere Faktoren, welche
die abgegebene akustische Leistung gegenüber der aufgenommenen
elektrischen Leistung reduzieren. In Boxen können sich z.B. Schallwellen
auslöschen, oder in sonstigen Materialien verloren gehen, ohne jemals
nach draußen zu dringen. Derartige Verluste werden oft bewußt in Kauf
genommen, um den Klirrfaktor zu reduzieren und damit eine Box überhaupt
erst "hochwertig" zu machen. Selbst die "hochwertigste" Box setzt die
zugeführte elektrische Leistung nicht zu 100% in akustische Leistung um.
IMO ist "hochwertig" ein Kompromiß zwischen gutem Wirkungsgrad und guter
Schwingungsabbildung. Ein besonders guter Wirkungsgrad wird bei einer
Resonanzfrequenz erreicht, doch im Interesse des Klirrfaktors darf ein
Lautsprecher in seinem Frequenzbereich garkeine Resonanzstellen
aufweisen!
> Es wird mitnichten aller realer Anteil des Widerstands für die Erwärmung
> verwendet, sondern nur der ohmsche Anteil.
Was ist bei Dir der Unterschied zwischen ohmisch und real? Oder meintest
Du "reell"?
> Bei f!=0 machen aber auch die
> "arbeitenden" Teile wie z.B. der bewegte Magnet einen realen Anteil der
> Impedanz aus, der Induktive geht dann dafür zurück (;der Induktive Anteil ist
> ja nur der Anteil, der wegen der Frequenz != 0 einen Teil der elektrischen
> Energie im Magnetfeld speichert, diese Energie geht ja bei Feldumkehr wieder
> raus und ist nicht verloren).
Auch hier handelt es sich um keine ideale Wiedergewinnung der
hineingesteckten Energie. Hauptzweck ist ja nicht die Erzeugung eines
Magnetfeldes, sondern daß dieses Magnetfeld die Membran des
Lautsprechers bewegt. Diese Bewegung ist einerseits erwünscht, sie
erzeugt ja den Schall, andererseits kann ihre Energie aber bei falscher
Phasenlage garnicht zurückgewonnen werden, sondern muß im Gegenteil
nochmals durch weitere Leistungszufuhr kompensiert werden.
> Lautsprecher haben z.T. schon recht gute Wirkungsgrade. Nichtlinearitäten
> entstehen im Grunde erst, wenn man den Strom zu weit hochfährt: Verluste bei
> Feldumkehr, mechanische Verluste (;Wärme) beim Fell, elektrische Verluste in
> der Spule.
Es würde mich hier einmal interessieren, in welcher Größenordnung so ein
Wirkungsgrad überhaupt liegt. Ein Verbrennungsmotor mit 30% ist ja auch
schon "recht gut" ;-)
Wie bereits erwähnt hätte man im Resonanzfall einen besonders hohen
Wirkungsgrad. Bei einem Lautsprecher kann man aber den Resonanzbereich
nicht beliebig breit machen, so daß er den jeweiligen Frequenzbereich
komplett abdecken könnte. Deshalb muß man umgekehrt die Resonanzfrequenz
(;auch der Box) aus dem Nutzfrequenzbereich hinausschieben, und die noch
verbliebenen Resonanzfrequenzen bedämpfen. Das klingt doch alles eher
nach einer Vernichtung von Energie, als nach einer Ausnützung mit hohem
Wirkungsgrad?
Einen sehr guten Wirkungsgrad habe ich schon mal bei einer kleinen
Sirene erlebt, die hat schon aus einer Batterie einen ohrenbetäubenden
Lärm produziert. Mit einem Lautsprecher wäre derselbe Krach jedenfalls
nur mit deutlich höherer Leistungsaufnahme zu erzeugen, also mit
deutlich niedrigerem Wirkungsgrad.
DoDi
Antwort von Axel Farr:
Hallo Hans-Peter,
"Hans-Peter Diettrich" schrieb im Newsbeitrag
Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
> Axel Farr wrote:
[schnippel]
Wir reden im Grunde an einander vorbei, denn den Ausdruck "guter
Wirkungsgrad" müßte man halt in Zahlen fassen. Ich bin kein
Lautsprecherakustiker, aber ich schätze die elektrischen Verluste eines
(;guten) Lautsprechers auf nicht mehr als ~20 - 50%, eher Richtung 20%. Klar,
akustische Verluste kommen noch dazu.
>> Es wird mitnichten aller realer Anteil des Widerstands für die Erwärmung
>> verwendet, sondern nur der ohmsche Anteil.
>
> Was ist bei Dir der Unterschied zwischen ohmisch und real? Oder meintest
> Du "reell"?
Folgendes: "reel" sind alle Zahlen, die keinen komplexen Anteil haben, aber
nicht gezwungenermaßen rational sind. Zahlen wie 1, 1/2, Pi, Wurzel(;2), e
etc. sind alle reel.
"Real" nennt man den Anteil einer komplexen Zahl, der eben nicht imaginär
ist. Eine Komplexe Zahl läßt sich immer in karthesischer Schreibweise
darstelen als z = a i*b, wobei a und b reele Zahlen und i die imaginäre
Einheit mit i*i=-1 ist. a ist zwar (;wenn man keine weiteren Einschränkungen
geltend macht) eine reele Zahl, aber ist hier eben auch der reale Anteil der
komplexen Zahl z. b ist.
>> Bei f!=0 machen aber auch die
>> "arbeitenden" Teile wie z.B. der bewegte Magnet einen realen Anteil der
>> Impedanz aus, der Induktive geht dann dafür zurück (;der Induktive Anteil
>> ist
>> ja nur der Anteil, der wegen der Frequenz != 0 einen Teil der
>> elektrischen
>> Energie im Magnetfeld speichert, diese Energie geht ja bei Feldumkehr
>> wieder
>> raus und ist nicht verloren).
>
> Auch hier handelt es sich um keine ideale Wiedergewinnung der
> hineingesteckten Energie. Hauptzweck ist ja nicht die Erzeugung eines
> Magnetfeldes, sondern daß dieses Magnetfeld die Membran des
> Lautsprechers bewegt. Diese Bewegung ist einerseits erwünscht, sie
> erzeugt ja den Schall, andererseits kann ihre Energie aber bei falscher
> Phasenlage garnicht zurückgewonnen werden, sondern muß im Gegenteil
> nochmals durch weitere Leistungszufuhr kompensiert werden.
Ich stelle fest, daß Dir scheinbar nicht so ganz klar ist, was Du da
schreibst.
Folgendes: Wenn die Membran sich bewegt und sie durch Umpolen des
Magnetfeldes gebremst wird, liefert sie durch das Induktionsgesetz
mechanische Energie zurück in das Magnetfeld (;die Felder von Permanentmagnet
und Spule sind sich ja entgegengerichtet, der Magnet komprimiert aber das
Feld, also wird die im Feld gespeicherte Energie größer). Das führt dann
direkt dazu, daß ein der elektrischen Spannung entgegengerichteter Strom
fließt, sprich: Der Lautsprecher liefert Energie an den Verstärker zurück.
Ob der damit etwas anfange kann ist eine andere Frage, aber in der Regel
wird diese Energie nicht zu 100% im Verstärker verheizt. Daß dabei natürlich
Strom fließt und der in den ohmschen Widerständen Wärme erzeugt ist klar.
>> Lautsprecher haben z.T. schon recht gute Wirkungsgrade. Nichtlinearitäten
>> entstehen im Grunde erst, wenn man den Strom zu weit hochfährt: Verluste
>> bei
>> Feldumkehr, mechanische Verluste (;Wärme) beim Fell, elektrische Verluste
>> in
>> der Spule.
>
> Es würde mich hier einmal interessieren, in welcher Größenordnung so ein
> Wirkungsgrad überhaupt liegt. Ein Verbrennungsmotor mit 30% ist ja auch
> schon "recht gut" ;-)
Siehe meine Bemerkung oben.
> Wie bereits erwähnt hätte man im Resonanzfall einen besonders hohen
> Wirkungsgrad. Bei einem Lautsprecher kann man aber den Resonanzbereich
> nicht beliebig breit machen, so daß er den jeweiligen Frequenzbereich
> komplett abdecken könnte. Deshalb muß man umgekehrt die Resonanzfrequenz
> (;auch der Box) aus dem Nutzfrequenzbereich hinausschieben, und die noch
> verbliebenen Resonanzfrequenzen bedämpfen. Das klingt doch alles eher
> nach einer Vernichtung von Energie, als nach einer Ausnützung mit hohem
> Wirkungsgrad?
Im Resonanzbereich ist der Wirkungsgrad nicht notwendigerweise hoch.
Resonanz kann auch bedeuten, daß Energie nicht abgegeben, sondern eben
resonant gespeichert wird - Resonanzen muß man eben auch "anfüttern", sie
sind nicht "einfach so" da.
> Einen sehr guten Wirkungsgrad habe ich schon mal bei einer kleinen
> Sirene erlebt, die hat schon aus einer Batterie einen ohrenbetäubenden
> Lärm produziert. Mit einem Lautsprecher wäre derselbe Krach jedenfalls
> nur mit deutlich höherer Leistungsaufnahme zu erzeugen, also mit
> deutlich niedrigerem Wirkungsgrad.
Es kommt dazu, daß das menschliche Ohr generell das (;vom Energiebedarf der
Anregung her gesehene) sensibelste Sinnesorgan überhaupt ist.
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Axel Farr:
Noch mal was für diejenigen, die sich für das ursprüngliche Thema
interessieren:
Die Northwood-Kerne des P4 (;deren Fertigung gerade ausläuft) galten ja lange
als den Prescotts (;die das aktuelle Modell darstellen) in Punkto
Energieverbrauch deutlich überlegen, Zahlen von ~120W für 3,2GHz Prescott
gegenüber 85W für 2,8GHz Northwood waren bei der Einführung der Prescotts so
die Werte, die man lesen konnte.
Scheinbar hat Intel aber auch den Stromhunger der Prescotts etwas in den
Griff bekommen, so daß deren Energiebedarf heute etwa auf dem Niveau des
Northwood-Kerns ohne HT liegt. Die "thermal design power" (;die kleiner ist
als die maximale Leistungsaufnahme) lag bei den Prescotts ursprünglich bei
~120W, sie ist bei den 775-Pin-Varianten bei den "kleineren" Taktfrequenzen
aber mittlerweile auf ~85W runter, bei den 478-Pin-Varianten liegt sie
durchweg bei ~90W. Zum Vergleich: Die "thermal design power" der Northwoods
lag bis zum Schluß auch bei ~85W, effektiv lagen die Prozessoren zum Schluß
beim Leerlauf bei ~45-55W selbst bei den Topmodellen und kamen bei Betrieb
nahe Vollast meist gerade so an diese TDP ran (;dieser Zahlenwert ist etwa
das, was man bei intensiven Berechnungen an Leistungsaufnahme erwarten kann,
nur sehr speziell auf den P4 und seine Struktur ausgerichteten Benchmarks
schaffen es, bis etwa 20% mehr Stromaufnahme zu produzieren). Erst die HT
(;Hyper-Threading)-Variante des Northwoods war effektiver, wurde aber erst
vor ca. 2 Jahren eingeführt.
Sprich: Der Prescott, der am Anfang deutlich schlechter da stand als der
Nortwood hat mittlerweile zumindest einiges aufgeholt. Ist dahingehend
wichtig, weil viele kompaktere Mainboards für HTPCs nach wie vor die
478-Pin-Variante des Sockels benutzen, die Northwoods aber mittlerweile am
Aussterben sind (;Intel will Ende Juni die Produktion einstellen,
Bestellungen waren nur bis Ende März möglich).
Unter
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2005/intels pentium 4 600-serie/6/
findet man ein Diagramm, das die Stromaufnahmen vergleicht. Da ist auch ein
kompletter PC bei der WMA-HD-Wiedergabe mit ca. 180W Leistungsaufnahme
genannt (;mit verschiedenen Prescott-Kernen). Dort sind auch die TDPs der
verschiedenen Prozessoren gegeneinander gestellt. Der Unterschied zwischen
aktuellen Prescotts bis 3,4 GHz und den letzten Northwoods mit bis zu 2,8GHz
und HT stellt sich etwa so dar: Prescott 90W TDP, Northwood 70W TDP.
Ist aber immer hin eine recht helle Glühbirne, die da im Rechnerinneren mit
Kühlluft versorgt werden muß...
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Hans-Peter Diettrich:
Axel Farr wrote:
> >> Es wird mitnichten aller realer Anteil des Widerstands für die Erwärmung
> >> verwendet, sondern nur der ohmsche Anteil.
> >
> > Was ist bei Dir der Unterschied zwischen ohmisch und real? Oder meintest
> > Du "reell"?
>
> Folgendes: "reel" sind alle Zahlen, die keinen komplexen Anteil haben, aber
> nicht gezwungenermaßen rational sind. Zahlen wie 1, 1/2, Pi, Wurzel(;2), e
> etc. sind alle reel.
>
> "Real" nennt man den Anteil einer komplexen Zahl, der eben nicht imaginär
> ist. Eine Komplexe Zahl läßt sich immer in karthesischer Schreibweise
> darstelen als z = a i*b, wobei a und b reele Zahlen und i die imaginäre
> Einheit mit i*i=-1 ist. a ist zwar (;wenn man keine weiteren Einschränkungen
> geltend macht) eine reele Zahl, aber ist hier eben auch der reale Anteil der
> komplexen Zahl z. b ist.
Danke für die Auffrischung, ich leide da möglicherweise noch an einer
Vermischung der mathematischen, programmtechnischen und
elektrotechnischen Begriffe. Bleibt trotzdem die Frage, warum der
ohmsche Anteil nicht genau der reale Anteil a sein soll? Die Impedanz
ist jedenfalls der komplexe Widerstand, d.h. die Länge des Vektors in
Polarkoordinaten.
> > Auch hier handelt es sich um keine ideale Wiedergewinnung der
> > hineingesteckten Energie. Hauptzweck ist ja nicht die Erzeugung eines
> > Magnetfeldes, sondern daß dieses Magnetfeld die Membran des
> > Lautsprechers bewegt. Diese Bewegung ist einerseits erwünscht, sie
> > erzeugt ja den Schall, andererseits kann ihre Energie aber bei falscher
> > Phasenlage garnicht zurückgewonnen werden, sondern muß im Gegenteil
> > nochmals durch weitere Leistungszufuhr kompensiert werden.
>
> Ich stelle fest, daß Dir scheinbar nicht so ganz klar ist, was Du da
> schreibst.
> Folgendes: Wenn die Membran sich bewegt und sie durch Umpolen des
> Magnetfeldes gebremst wird, liefert sie durch das Induktionsgesetz
> mechanische Energie zurück in das Magnetfeld (;die Felder von Permanentmagnet
> und Spule sind sich ja entgegengerichtet, der Magnet komprimiert aber das
> Feld, also wird die im Feld gespeicherte Energie größer). Das führt dann
> direkt dazu, daß ein der elektrischen Spannung entgegengerichteter Strom
> fließt, sprich: Der Lautsprecher liefert Energie an den Verstärker zurück.
> Ob der damit etwas anfange kann ist eine andere Frage, aber in der Regel
> wird diese Energie nicht zu 100% im Verstärker verheizt. Daß dabei natürlich
> Strom fließt und der in den ohmschen Widerständen Wärme erzeugt ist klar.
Mir ist eigentlich schon klar, was ich schreibe, höchstens daß ich mich
unklar ausgedrückt habe.
Zum Aufbau eines Magnetfelds wird Energie hineingesteckt, die beim Abbau
wieder freigesetzt wird (;abzüglich Verluste). Nur handelt es sich beim
Lautsprecher nicht um eine ideale Spule, sondern um ein gekoppeltes
System, auf dessen Komponenten (;Spule, Magnet, Membran, umgebende Luft)
die Energie verteilt wird. Dieses System bestimmt auch den Verlauf der
Rückbewegung der Spule, und nur diese Bewegung induziert einen Strom in
der Spule. Solange der induzierte Strom in Phase mit der vom Verstärker
gelieferten Spannung ist, muß der Verstärker um diesen Anteil weniger
Strom (;und damit Leistung) liefern.
Die Luft tritt in diesem System zunächst als Dämpfung in Erscheinung, da
sie ja von der Membran zuerst in die eine Richtung beschleunigt wird,
danach wieder in die entgegengesetzte Richtung. Erst wenn die Luft die
gewünschte Geschwindigkeit in der richtigen Richtung hat, unterstützt
sie die weitere Auslenkung der Membran, und reduziert damit den
hineinzusteckenden Strom. Damit steht Dein Argument mit der
Rückgewinnung der Energie auf recht wackligen Füßen, zumal ja die
Bewegung der Luft den eigentlichen (;Wirk-)Anteil der gewünschten
elektrisch-akustischen Umwandlung
darstellt.
Womit wir zu einer weiteren Frage kommen, nämlich dem Winkel der
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Dem Verstärker wäre es
ja am liebsten, wenn beide in Phase sind, d.h. je höher die Spannung,
desto höher soll der Strom sein. Dann ist nicht nur die abgegebene
Leistung am höchsten, sondern auch die Verlustleistung am geringsten,
weil dann an den Transistoren (;oder Röhren) in der Endstufe bei hohem
Strom nur wenig Spannung abfällt. Bei einer reinen Spule sind aber Strom
und Spannung um 90° verschoben, also kein sehr erfreulicher Wert.
Deshalb sorgt man meist durch Filter und Phasenschieber dafür, daß sich
eine Box möglichst wie ein reeller (;ohmscher) Widerstand verhält, ohne
induktive oder kapazitive (;imaginäre) Anteile.
Deshalb kannst Du Deine Argumentation einfach nicht an den elektrischen
Eigenschaften einer Spule aufziehen, die hätte nämlich (;außer im
Resonanzfall) einen ganz miserablen Wirkungsgrad des Verstärkers zur
Folge.
> Im Resonanzbereich ist der Wirkungsgrad nicht notwendigerweise hoch.
> Resonanz kann auch bedeuten, daß Energie nicht abgegeben, sondern eben
> resonant gespeichert wird - Resonanzen muß man eben auch "anfüttern", sie
> sind nicht "einfach so" da.
Eigentor! Energie muß immer hineingesteckt werden, mit einem Minimum in
einer Resonanzstelle. Eine erzwungene Schwingung hingegen bedeutet eine
erhöhte Leistungszufuhr, und statt einer Rückgewinnung von Energie muß
der Verstärker zusätzlich noch gegen das aufgebaute Magnetfeld
ankämpfen. Und selbst im Idealfall, mit vollstäniger Rückgewinnung der
Energie, kann nichts nach außen abgegeben werden, eine solche Resonanz
erzeugt also bestenfalls Verluste (;am ohmschen Widerstand).
Und noch ein Wort zu den hochwertigen Lautsprechern. So ein Lautsprecher
darf keine Resonanzen aufweisen, die nicht elektrisch korrigiert werden
können (;Glättung der Kennlinie durch Filter). Z.B. darf die Membran
keine unkontrollierten Eigenschwingungen ausführen, deshalb sind die
Membranen oft nicht eben, sondern in sich gekrümmt, um ihre Steifigkeit
ohne Materialverstärkung (;zusätzliches Gewicht) zu erhöhen.
Lautsprecher können auch nicht alleine eingesetzt werden, da speziell
bei niedrigen Frequenzen ein großer Teil des Schalls im akustischen
Kurzschluß außen um die Membran herum verloren geht. In einer
geschlossenen Box muß die Hälfte des Schalls in der Box vernichtet
werden, nur der von der Vorderseite der Membran erzeugte Schall kann an
die Umgebung abgegeben werden. Damit können geschlossene Boxen
bestenfalls einen Wirkungsgrad von 50% erreichen. Zudem sollte der in
die Box abgegebene Schall dort vernichtet werden, und nicht mit
unbrauchbaren (;frequenzabhängigen) Phasenverschiebungen erneut auf die
Membran auftreffen. Dies dürfte speziell bei kleinen Brüllwürfeln nicht
erfüllt sein.
In Baßreflexboxen wird AFAIK der rückwärtige Schall durch eine
Laufzeitverlängerung um etwa 180° gedreht, und kann dann ebenfalls
abgegeben werden. Bei einer Drehung um 360° könnte er immerhin bewirken,
daß an der Rückseite der Membran ein weit geringerer Luftwiderstand
wirkt, als dies in einer einfachen geschlossenen Box der Fall wäre. Da
so eine Phasendrehung durch Laufzeitverlängerung nur in einem ganz engen
Frequenzbereich einigermaßen zufriedenstellend funktioniert, ist dieses
Verfahren auf schmalbandige Boxen (;eben Bässe) beschränkt.
Beim Wirkungsgrad der Verstärker sehe ich auch Probleme, wenn ein
Verstärker (;üblicherweise) unterhalb seiner Nennleistung betrieben wird.
Dann muß nämlich bis zur Hälfte der Versorgungsspannung in der Endstufe
vernichtet werden, und nur der gleichzeitig sinkende Ausgangsstrom hält
die Verluste überhaupt noch in Grenzen. Nehmen wir als Beispiel einen
Verstärker mit 100 Watt an 4 Ohm. Aus PU*I und UI*R folgt dann ein
effektiver Strom von I = sqrt(;100/4) = 5A und eine Spannung von U =
sqrt(;100*4) = 20V effektiv bzw. 20*2*sqrt(;2) = 56V peak-peak, d.h. rund
60Vpp (; -30V) Spannung an der Endstufe. Nehmen wir für Zimmerlautstärke
mal eine Ausgangsleistung von 9 Watt an, dann entspricht das einer
Spannung von sqrt(;9*4) = 6V und einem Strom von sqrt(;9/4) = 1,5A. Da an
der Endstufe aber -30V anliegen, bleiben abzüglich der abgegebenen 6V
noch 24V*1,5A = 36W Verlustleistung übrig, ein Wirkungsgrad von gerade
mal 20%. Mit einem (;sehr) optimistischen Wirkungsgrad der Boxen von 20%
kommen dann noch 4% der hineingesteckten Leistung als Schall heraus.
> Es kommt dazu, daß das menschliche Ohr generell das (;vom Energiebedarf der
> Anregung her gesehene) sensibelste Sinnesorgan überhaupt ist.
Zum Glück ist das Ohr nach dem Auge eines der empfindlichsten
Sinnesorgane, deshalb dürfte Zimmerlautstärke auch heute noch unter 1
Watt liegen, so daß HiFi Freaks beim Zuhören nicht gebraten werden,
selbst bei einem realistischen Wirkungsgrad ihrer Anlage von weit unter
1%. Wer aber ganz sparsam sein will, der sollte auf Kopfhörer umsteigen,
die brauchen erstens fast keine Leistung, und sind auch in der
Anschaffung billiger als ein Sensuround Boxen-Zoo.
Zum Disco-Feeling fehlt dann allerdings noch ein umschnallbarer
"Bauchhörer" - aber vielleicht kommt der ja mit der übernächsten
Generation der Spiele-Konsolen, zur Simulation von Tiefschlägen oder dem
Rattern auf der Piste. Die Wellness-Ausführung massiert dann beim
Spielen gleich noch die Fettpolster weg, die sich sonst aufgrund des
Bewegungsmangels so breit machen ;-)
DoDi
Antwort von Alan Tiedemann:
Axel Farr schrieb:
> "Hans-Peter Diettrich" schrieb im Newsbeitrag
> Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
Bitte kürze obigen Roman auf eine Zeile. Danke!
>> Was ist bei Dir der Unterschied zwischen ohmisch und real? Oder meintest
>> Du "reell"?
>
> Folgendes: "reel"
Du meinst "reell" ;-) JFTR.
> sind alle Zahlen, die keinen komplexen Anteil haben, aber
> nicht gezwungenermaßen rational sind. Zahlen wie 1, 1/2, Pi, Wurzel(;2), e
> etc. sind alle reel.
"reell". Ack.
Gruß,
Alan
> Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
PS: Eine gefälschte Mailadresse? Ich hoffe die mit dem Punkt gehört auch
Dir und nicht irgendjemand anders...
PPS: Wegen OT Fup2P.
--
Bitte nur in die Newsgroup antworten! Re:-Mails rufe ich nur selten ab.
http://www.schwinde.de/webdesign/ ~ http://www.schwinde.de/cdr-info/
Mail: at 0815hotmailcom ~ news-2003-10schwindede
Antwort von Axel Farr:
Hallo Alan,
"Alan Tiedemann" schrieb im Newsbeitrag
Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
> Axel Farr schrieb:
>> "Hans-Peter Diettrich" schrieb im Newsbeitrag
>> news:428CA519.D440D426@compuserve.de...
>
> Bitte kürze obigen Roman auf eine Zeile. Danke!
>
>>> Was ist bei Dir der Unterschied zwischen ohmisch und real? Oder meintest
>>> Du "reell"?
>>
>> Folgendes: "reel"
>
> Du meinst "reell" ;-) JFTR.
Ja! Sorry...
> PS: Eine gefälschte Mailadresse? Ich hoffe die mit dem Punkt gehört auch
> Dir und nicht irgendjemand anders...
>
> PPS: Wegen OT Fup2P.
Die gehörte mir mal. Ich habe den Mailaccount bei T-Online nach den ersten
Mass-Mailwürmern umbenannt, da ich mir nicht jeden Tag 1 MByte Wurmcode von
T-Online per ISDN runterladen wollte, nur um den dann gleich wieder zu
löschen...
(;Die Diskussionen um ungültige Mail-Adressen in Newsgroup-Posts kenne ich
und würde so einen Murks auch nie machen, wenn nicht diese unsägliche
Spammer-Mafia auf alles geiern würde, was ein @-Zeichen in der Mitte hat)
Antwort von Axel Farr:
Hallo Hans,
"Hans-Peter Diettrich" schrieb im Newsbeitrag
Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
> Axel Farr wrote:
>
>> >> Es wird mitnichten aller realer Anteil des Widerstands für die
>> >> Erwärmung
>> >> verwendet, sondern nur der ohmsche Anteil.
>> >
>> > Was ist bei Dir der Unterschied zwischen ohmisch und real? Oder
>> > meintest
>> > Du "reell"?
>>
>> Folgendes: "reel" sind alle Zahlen, die keinen komplexen Anteil haben,
>> aber
>> nicht gezwungenermaßen rational sind. Zahlen wie 1, 1/2, Pi, Wurzel(;2), e
>> etc. sind alle reel.
>>
>> "Real" nennt man den Anteil einer komplexen Zahl, der eben nicht imaginär
>> ist. Eine Komplexe Zahl läßt sich immer in karthesischer Schreibweise
>> darstelen als z = a i*b, wobei a und b reele Zahlen und i die imaginäre
>> Einheit mit i*i=-1 ist. a ist zwar (;wenn man keine weiteren
>> Einschränkungen
>> geltend macht) eine reele Zahl, aber ist hier eben auch der reale Anteil
>> der
>> komplexen Zahl z. b ist.
>
> Danke für die Auffrischung, ich leide da möglicherweise noch an einer
> Vermischung der mathematischen, programmtechnischen und
> elektrotechnischen Begriffe. Bleibt trotzdem die Frage, warum der
> ohmsche Anteil nicht genau der reale Anteil a sein soll? Die Impedanz
> ist jedenfalls der komplexe Widerstand, d.h. die Länge des Vektors in
> Polarkoordinaten.
Ganz einfach: Wir haben ja kein völlig abgeschlossenes System vor uns, das
lediglich elektrische Energie in Wärme verwandelt (;dann wäre es so wie Du
vermutest). Da wir auch Luftbewegungen aka Schall erzeugen, geht ein Teil
der elektrischen Energie eben auch in diese Form der Energie - ergo muß der
Realteil der Impedanz größer sein als der ohmsche Anteil. Wäre er gleich
groß, dann würde ja alles wieder verheizt und nichts würde übrigbleiben für
die Energieumwandlung.
Man kann dieses Verhalten (;elektrische Energie wird in mechanische Energie
umgesetzt) auf zwei Arten erklären: Obige Beschreibung paßt auf das Modell,
daß alles, was an den zwei Anschlüssen des Lautsprechers nach außen
elektrisch sichtbar ist eine komplexe Impedanz Z mit einem gewissen Betrag
|Z| ist, wobei |Z| meisten außen drauf steht und irgendwas von 2 bis 32 ist
(;bei den Lautsprechern die ich kenne, aber es gibt bestimmt noch andere).
Die andere Art, so etwas elektrisch zu beschreiben verwendet man meist bei
Motoren o.Ä.. Dabei stellt man den Motor nicht nur als ein passives
Bauelement dar, das nur einen komplexen Innenwiderstand Z hat (;hier durch
Wicklugnswiderstand und -induktivität beschrieben), sondern es ist auch ein
aktives Bauelement mit einer Spannungsquelle, die bei einem konstant
erregten Motor linear von der Drehzahl abhängig ist. Diese Spannung ist die
sogenannte Gegen-EMK. Betrachtet man beide Modelle, dann stellt man fest,
daß diese Gegen-EMK scheinbar zu einem viel höheren reellen Anteil der
Impedanz führt als es der ohmsche Widerstand alleine ausmacht. Beim Motor
wird aber leicht ein Faktor von 10:1 erreicht, das heißt, daß weniger als
10% der elektrischen Energie in der Wicklung "verheizt" werden. Aber ein
Lautsprecher ist mit einem Motor nur in der Nähe des Resonanzfalls
vergleichbar, da der aber beim Lautsprecher vermieden werden muß hinkt das
ganze ziemlich.
[den Rest habe ich geschnippelt]
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Hans-Peter Diettrich:
Axel Farr wrote:
> Ganz einfach: Wir haben ja kein völlig abgeschlossenes System vor uns, das
> lediglich elektrische Energie in Wärme verwandelt (;dann wäre es so wie Du
> vermutest).
So habe ich das nie vermutet (;s.u.).
> Da wir auch Luftbewegungen aka Schall erzeugen, geht ein Teil
> der elektrischen Energie eben auch in diese Form der Energie - ergo muß der
> Realteil der Impedanz größer sein als der ohmsche Anteil. Wäre er gleich
> groß, dann würde ja alles wieder verheizt und nichts würde übrigbleiben für
> die Energieumwandlung.
Du hast recht, der Realteil der Impedanz hat mit dem ohmschen Widerstand
wenig zu tun, da war ich tatsächlich im Irrtum.
Ein ohmscher Widerstand läßt sich aber durch keine Maßnahme (;Gegen-EMK
o.ä.) kompensieren, der durch ihn hindurchfließende Strom wird restlos
in Verlustleistung (;Wärme) umgesetzt. Eine Wirkleistung kann natürlich
trotzdem erzielt werden, wenn derselbe Strom durch weitere Elemente
(;Spule...) fließt. Das habe ich nie bestritten, wir haben nur viel
aneinander vorbeigeredet :-(;
Nicht einverstanden bin ich aber mit Deiner Darstellung, daß die am
Realteil der Impedanz anfallende Leistung direkt als Wirkleistung
(;Schall) abgegeben wird. Da können neben dem ohmschen Anteil noch
etliche weitere Verluste auftreten. Ich nehme jedoch an, daß wir uns
darüber eigentlich auch einig waren, und nur viel aneinander
vorbeigeredet haben.
DoDi
Antwort von Axel Farr:
Hallo Hans-Peter,
"Hans-Peter Diettrich" schrieb im Newsbeitrag
Re: Heimkino-PC ohne Stromfresser###
{schnippel}
> Nicht einverstanden bin ich aber mit Deiner Darstellung, daß die am
> Realteil der Impedanz anfallende Leistung direkt als Wirkleistung
> (;Schall) abgegeben wird. Da können neben dem ohmschen Anteil noch
> etliche weitere Verluste auftreten. Ich nehme jedoch an, daß wir uns
> darüber eigentlich auch einig waren, und nur viel aneinander
> vorbeigeredet haben.
Das mit den Verlusten ist klar. Es ist halt die Frage, was man auf welcher
Seite (;als Wirk- oder Verlustleistung) rechnen möchte. Im Endeffekt wird
halt alles wieder in Wärme verwandelt...
Gruß, Axel
--------------------------------------------------
Für Antworten bitte ohne Punkt im Namen!
Antwort von Norbert Huebel:
Axel Farr schrieb:
> Das mit den Verlusten ist klar. Es ist halt die Frage, was man auf
> welcher Seite (;als Wirk- oder Verlustleistung) rechnen möchte. Im
> Endeffekt wird halt alles wieder in Wärme verwandelt...
Ich lauschte Eurer Diskussion mit wachsendem Interesse (;Bei mir kommt
aus den Lautsprechern halt einfach -meistens- Musik raus...)
Das man die auch so penibel ausrechnen kann:
(;also 3 x 9 hoch Impedanz minus Schwellwert 3 Ohm = Metallica?)
war mir allerdings neu:)
Und schoen, dass ihr Euch wieder vertragt, aber eine letzte Frage
bleibt noch offen: wer hatte jetzt recht? Mir ist die Ursprungs-
Problematik verloren gegangen;-)
SCNR...
Norbert
Antwort von Hans-Peter Diettrich:
Norbert Huebel wrote:
>
> Axel Farr schrieb:
>
> > Das mit den Verlusten ist klar. Es ist halt die Frage, was man auf
> > welcher Seite (;als Wirk- oder Verlustleistung) rechnen möchte. Im
> > Endeffekt wird halt alles wieder in Wärme verwandelt...
>
> Ich lauschte Eurer Diskussion mit wachsendem Interesse (;Bei mir kommt
> aus den Lautsprechern halt einfach -meistens- Musik raus...)
> Das man die auch so penibel ausrechnen kann:
> (;also 3 x 9 hoch Impedanz minus Schwellwert 3 Ohm = Metallica?)
> war mir allerdings neu:)
>
> Und schoen, dass ihr Euch wieder vertragt, aber eine letzte Frage
> bleibt noch offen: wer hatte jetzt recht? Mir ist die Ursprungs-
> Problematik verloren gegangen;-)
Mal nachgeschaut, es ging eigentlich um den Wirkungsgrad "hochwertiger"
Boxen. Diesen Bezug haben wir unterwegs ziemlich verloren. In diesem
Punkt bin ich weiterhin der Meinung, daß der Wirkungsgrad einer Box um
so schlechter ist, je "hochwertiger" (;Hi-Fi) sie ist. Billige
Brüllwürfel müssen dagegen nur möglichst laut brüllen, ohne auf
Frequenzgang, Verzerrungen etc. Rücksicht zu nehmen. Bei hochwertigen
Boxen, mit großer Klangtreue, muß IMO in der Box viel Schall vernichtet
werden (;Reflexionen, Resonanzen...), womit der Wirkungsgrad zwangsläufig
abnimmt. Leider wird man kaum brauchbare Daten zum Wirkungsgrad einer
Box finden, mit denen der Streit einfach zu schlichten wäre.
Geht man noch ein Stück zurück (;siehe Betreff), dann denke ich, daß ein
Verstärker mit 5-10 Watt (;sinus) für Zimmerlautstärke dicke ausreicht,
wenn man billige Boxen mit einem entsprechend hohen Wirkungsgrad nimmt.
Je mehr Leistung der Verstärker abgeben kann, desto höhere Verluste muß
man bei geringem Leistungsbedarf in Kauf nehmen - siehe dazu das
Rechenexempel, zu dem ich immer noch stehe.
> SCNR...
Wer so geduldig mitliest, der darf sich ruhig auch mal äußern. Ich habe
ja schon länger darauf gewartet, daß irgendjemand wegen soviel OT
anfängt zu meckern.
BTW, mit Akustik befasse ich mich nurmehr theoretisch. Meine
selbstgebauten Radios brachten keinen Empfang, ganz im Gegensatz zu
meinen Verstärkern, und das hat mich so genervt, daß ich sofort zur
Digitaltechnik übergewechselt bin, als ich dazu die ersten Schaltbilder
in Händen hielt (;~1966). Ein einziger Ausrutscher ist mir danach noch
passiert, als wir einen Verstärker für den Hausgebrauch in einer
Kleinserie bauen wollten. Der war dann leider eher als Lichtorgel zu
verwenden, die Röhren in der Endstufe haben so schön blau geleuchet.
Später erfuhr ich dann, daß das ein Zeichen dafür ist, daß die Endstufe
im HF-Bereich schwingt. Also zur Abwechslung mal kein Verstärker als
Radio-Empfänger, sondern als Sender. Damit hatte ich eigentlich alles
abgegrast, was man an analogen Schaltung falsch machen kann, und mir
forthin nur noch funktionierende Geräte zugelegt. Meine Computer haben
dagegen recht gut funktioniert, den letzten habe ich etwa 1985 gebaut.
Danach habe ich mir auch nur noch fertige Rechner gekauft, die waren ab
da billiger als die selbstgebauten.
DoDi