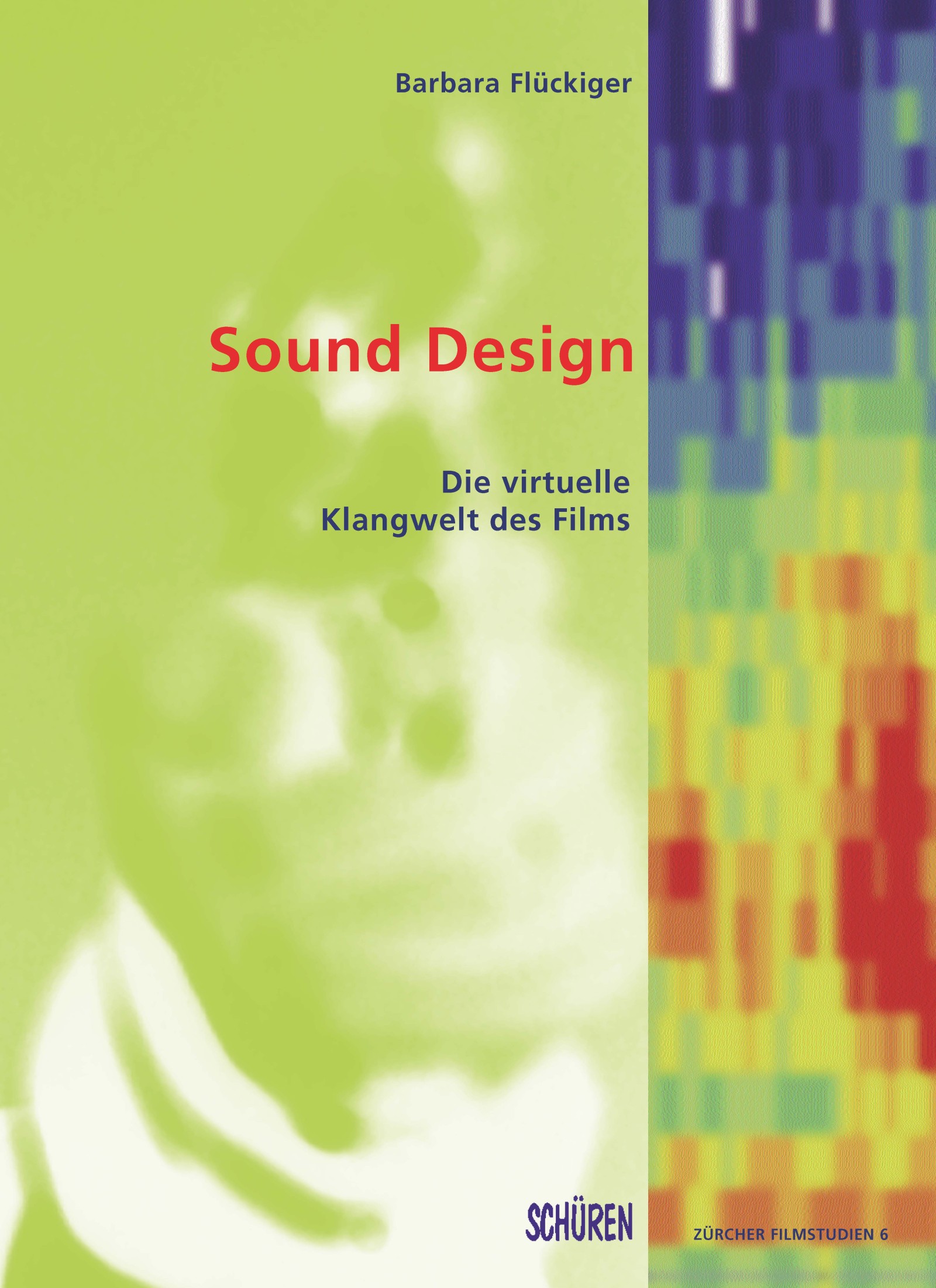TomStg hat geschrieben: ↑Fr 14 Jun, 2024 10:07
ruessel hat geschrieben: ↑Fr 14 Jun, 2024 08:47
Für mich ist es eher bezeichnend, wie hoch die Erwartungshaltung hier ist. "Bäh....ist alles scheiße."
Es wird vom Verlag kostenlos angeboten (Warum wohl), nur weil es nix kostet muss man es doch nicht annehmen und auch noch im Detail begründen warum das oder dies einem nicht gefällt, einfach reinschauen und dann gegenfalls löschen - kostet doch nix.
Merkwürdige Logik:
Weil es kostenlos ist, darf es so grottenschlecht formuliert sein, dass man nicht weiterlesen möchte?
Fass Dir besser an die eigene Nase: So ein schlimm geschriebenes Werk hier öffentlich anzupreisen, sollte man lieber vermeiden. Hast Du es überhaupt gelesen?
Also, wenn das Buch vom Verlag schon kostenlos verteilt wird, darf man vielleicht auch einen Ausschnitt daraus hier zitieren. Die Audio-Spezialisten hier im Forum können besser beurteilen als ich, ob in dem Text irgendwo ein sachlicher Fehler steckt, aber es geht hier ja um die Verständlichkeit des Textes bzw. die angebliche Unverständlichkeit des gesamten Buches, das sich mit der Schnittstelle Technik<>Mensch beim Filmton und Ton allgemein beschäftigt.
Auszug aus dem Kapitel 7 Dynamik
(Zitat)
Wahrnehmung der Lautstärke
Die akustische Dimension, für welche man im alltäglichen Sprachgebrauch den Begriff Lautstärke verwendet, wird als Schalldruckpegel bezeichnet. Da bereits ein mittlerer Schalldruck die leisesten noch wahrnehmbaren Töne um ein Tausendfaches übersteigt, wird der Schalldruckpegel als logarith- misches Maß in Dezibel angegeben. Dezibel (dB) sind relative Werte und bezeichnen Verhältnisse eines Schalldrucks p zu einer vorgegebenen Referenz p0 von 2*10^(–5) Pa (Pascal), als Formel ausgedrückt: Schalldruckpegel Lp = 10*log (p/p0)^2. Eine Verdoppelung des Schalldrucks entspricht einem Zuwachs von lediglich 6 dB, eine Verzehnfachung einem Zuwachs von 20dB; 120dB entsprechen einer Zunahme um den Faktor 1 Million. Da das Ohr in verschiedenen Frequenzbereichen unterschiedlich empfindlich ist (→ isophonische Hörkurven 200), wird die Lautstärkeempfindung häufig gewichtet in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. Dafür haben sich die Bezeichnungen dB (A), dB (B) und dB (C) etabliert, welche aufgrund von spezifischen Filterkurven die Empfindungen des Ohrs nachbilden.
Zwischen Lautstärke und Tonhöhe besteht eine weitere Beziehung. Psychoakustiker haben schon im 19. Jahrhundert bemerkt, dass sich die Empfindung der Tonhöhe eines reinen Sinustons in Abhängigkeit von der Intensität, mit welcher er dargeboten wird, verändert, und zwar mit folgenden Gesetzmäßigkeiten: Eine Zunahme der Intensität bewirkt bei hohen Tönen eine Erhöhung, verändert wenig in mittleren Tonlagen und lässt tiefe Töne noch tiefer erscheinen (Buser/Imbert 1987: 40).
...
...
(Zitat Ende)
Hinweis:
Beim Kopieren ist in den Formeln das "hoch" (Potenzieren) nicht mitgekommen.
Ich habe deshalb ^ (für 'hoch') ergänzt und den zugehörigen Wert in Klammern geschrieben, falls auch ein Minuszeichen davorsteht:
p0 = 2*10^(–5) Pa (Pascal) -> p0 (gelesen "p Null"), '0' eigentlich kleiner und tiefgestellt, als Index, dass dies ein Startpunkt (Referenzwert) ist.
Lp = 10*log (p/p0)^2
Jetzt kann jeder selbst beurteilen, ob dieser Text (als
ein Beispiel) unverständlich ist oder verständlich, ob er sachlich stimmt oder nicht, ob man ihn besser hätte formulieren können und ob er generell informativ ist oder nicht.
Nachtrag:
Noch kurz die Zielsetzung des Buchs (der Arbeit) seitens der Autorin:
(Zitat)
Große Teile des Publikums – aber auch Kritiker und Filmwissenschaftler – fassen die Tonspur als natürliche Komponente der fiktionalen Welt auf, die einfach da ist.
Das Ziel meiner Arbeit ist es,
• Konventionen und scheinbare Selbstverständlichkeiten zu durchleuchten,
• die Funktionen der Tonspur als Bedeutungsträger zu verstehen,
• die Achse Ton-Bild in ihrer Beziehungsvielfalt abzutasten und
• die Tonspur als komplexe Architektur einer virtuellen Klangwelt ver-
ständlich zu machen.
Bildlich gesprochen, versuche ich, die Tonspuren zu zerpflücken, ihre Ele- mente in die Luft zu werfen, wieder einzusammeln und neu zu sortieren. Mein Augenmerk richtet sich dabei auf jenes Element der akustischen Repräsentation, das bis heute nur wenig beachtet wurde: das Geräusch.
...
...